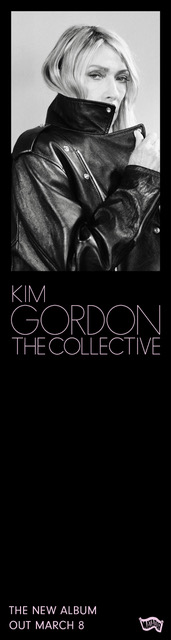Der umherschweifende Podiumsproletarier
Keine besonders originelle Feststellung, aber seine eigene Stimme auf einem Interviewmitschnitt zu hören (radebrechend, zu laut lachend) kann die Hölle sein. Thomas Meinecke hingegen hat eine sehr angenehme Stimme. Sowohl was den Klang als auch die Sprachmelodie angeht. Von daher ergibt es Sinn, dass er eine Radiosendung moderiert, auf Tonträgern der Band F.S.K. als Sänger zu hören ist und außerdem Lesungen macht, bei denen er aus seinen Romanen vorliest.
Ende letzten Jahres ist die Liste seiner Bücher um „Selbst“ (Suhrkamp) erweitert worden, einen Roman, der die Themen Gender Studies, Popkultur und Postkolonialismus auf elegant-verführerische Weise mit einem „Diskurs der Zärtlichkeit“ (so der Autor) kurzschließt.
Meinecke erzählt nicht dadurch, dass er sich eine Geschichte ausdenkt – das Ausgedachte ist seine Sache nicht. Vielmehr konstituiert sich Erzählen bei ihm über eine Neukombinatorik von bereits existierenden Theorien, Textsorten und Subjekten. Indem alle Themenfelder aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst und re-arrangiert werden, produzieren sie Differenz und Uneigentlichkeit. So bleibt Meineckes Ansatz stets der Künstlichkeit verpflichtet, die die Postmoderne gegen alles Authentische verteidigt – auch wenn „Selbst“ das Aufkommen neuer „post-postmoderner“ Kontaktzonen in Gestalt des spekulativen Realismus oder dem Konzept der Affekttheorie bereits mitreflektiert.
Ich würde gern mit dem letzten Satz des Romans anfangen, der lautet: „Dann löst sich alles Wahrgenommene erneut in die übliche Kakophonie auf.“ Als ich das gelesen hatte, dachte ich kurz, der Satz könnte als Lektüreschlüssel für den gesamten Roman dienen, ganz im Sinne der hermeneutischen Erkenntnis, dass das Ganze sich von seinen Teilen her erhelle. Aber eigentlich stimmt das nicht ganz, denn der Roman ist ja nicht kakophon strukturiert, oder?
![]() Thomas Meinecke: Der Roman ist nicht kakophon strukturiert, denn es gibt durchaus eine Struktur. Kakophonie würde wahrscheinlich bedeuten, es gäbe keine Struktur. Aber trotzdem kommt es einem so vor. Dieser Satz, den du zitierst, kann leicht selbstironisch verstanden werden. Im Grunde gebe ich da den Leuten Rückenwind, die das, was ich schreibe nicht mögen, weil die Kombination von verschiedenen Textsorten beliebig sei. Die Idee der Kakophonie bezieht sich auf einen realen Moment, den ich in London erlebt habe, als ich von Umweltgeräuschen geweckt wurde, die sich plötzlich zu einer Art Akkord verdichtet hatten, der sich aber ebenso plötzlich wieder auflöste in die Banalität von Kehrmaschinen und Verkehrslärm.
Thomas Meinecke: Der Roman ist nicht kakophon strukturiert, denn es gibt durchaus eine Struktur. Kakophonie würde wahrscheinlich bedeuten, es gäbe keine Struktur. Aber trotzdem kommt es einem so vor. Dieser Satz, den du zitierst, kann leicht selbstironisch verstanden werden. Im Grunde gebe ich da den Leuten Rückenwind, die das, was ich schreibe nicht mögen, weil die Kombination von verschiedenen Textsorten beliebig sei. Die Idee der Kakophonie bezieht sich auf einen realen Moment, den ich in London erlebt habe, als ich von Umweltgeräuschen geweckt wurde, die sich plötzlich zu einer Art Akkord verdichtet hatten, der sich aber ebenso plötzlich wieder auflöste in die Banalität von Kehrmaschinen und Verkehrslärm.
Ich fand es ganz reizvoll, diesen Gedanken noch mal aufzugreifen, der ganz am Anfang des Buchs geäußert wird. Es geht darum, dass Lady Gaga auf ihrem Innenarm ein Rilkezitat tätowiert hat, wo es heißt „muss ich eigentlich schreiben, um nicht verrückt zu werden?“ Dieses Motiv, am Ende noch einmal aufzugreifen, ist in gewisser Weise tongue-in-cheek, in dem Sinne, dass der Autor für einen kurzen Moment denkt, er sei verrückt geworden, weil alles ganz harmonisch klingt. Es ist eigentlich gedacht als Trost, vergleichbar mit dem Moment, wenn die Kirche vorbei ist: man entlässt die Leute mit einem Segen.
Gerade hatte ich ein Interview beim Dom-Radio – dadurch kommt vielleicht auch noch eine theologische Komponente ins Spiel – also indem die Engel ein Konzert geben. Aber die Engel sind dann wieder diese körperlosen Wesen, nachdem die Leser_innen sich vorher 400 Seiten lang durch den Wahnsinn des Körpers according to Jean Luc Nancy gearbeitet haben. Das sind immer so kleine Twists, die vielleicht sogar witzig sind.
Das Witzige entsteht ja auch dadurch, dass Verschiedenes collagiert wird. Auf diese Weise wird eine Art Bedeutungsfreiraum geschaffen. Im Prinzip der Collage ist ja angelegt, dass es Brüche gibt, die nicht verkittet werden.
Genau. Ich habe oft das Gefühl, dass mein Ansatz damit vergleichbar ist, auf dem Computer zehn Fenster gleichzeitig zu öffnen, die sich nicht unbedingt in Beziehung zueinander stehen. Dadurch entsteht der Eindruck eines Haufens.
Dieses Prinzip geht ja auf Kosten von Handlung. Bist du explizit gegen Handlung eingenommen? Oder ist das zu scharf formuliert?
Das ist zu scharf formuliert. Andere dürfen das ja gern. Ich habe aber für mich eine Poetologie entwickelt, bei der die ganze Handlung gedacht wird, in der Hinsicht, dass die Leser_innen sich irgendwohin denken.
Wo denken Sie hin? Es geht mir um die Denkbewegung. Natürlich fahren meine Figuren auch mal Auto. Oder die Haare werden länger. Aber es ist tatsächlich nicht mein primäres Interesse, diese Prozesse abzubilden. Ich habe dann immer das Gefühl, dass ich mir etwas ausdenke! Ich hatte einmal die Idee, ein Theaterstück zu schreiben, aber allein die Vorstellung in Klammern zu schreiben „alle ab“ hat mich fertiggemacht. Da war mir klar, dass ich so etwas nicht kann und will. Das ist einfach zu ausgedacht. Insofern lasse ich meine Leute immer anhand von Texten sich abarbeiten. Das ist vielleicht relativ statisch, in gedanklicher Hinsicht allerdings nicht.
Was mit der Zurückdrängung von Handlung einhergeht, ist die oft festgestellte Zeichenhaftigkeit der Figuren bei dir. In dieser Hinsicht ist es wirklich das Gegenteil von etwa Uwe Johnson, der explizit von Personen spricht und sagt, er habe Gesine Cresspahl, die Protagonistin des Romanprojekts Jahrestage, auf der 42. Straße in Manhattan gesehen.
Aber in meinen Romanen gibt es ja Figuren, die unter ihrem Originalnamen vorkommen und in der Wirklichkeit existieren. Natürlich heißt das noch lange nicht, dass ich mich mit deren gesamter Biographie befasse. Es verhält sich eher so, dass die Figuren als Träger einer Idee fungieren oder eine bestimmte Funktion erfüllen. In meinem letzten Roman gab es etwa eine in Salvador de Bahia lebende Figur namens Wiebke Kannengießer, die für das Goethe-Institut arbeitet und ihre Magisterarbeit über Hubert Fichte schreibt. In dieser Rolle kommt sie vor und sie wird auch von mir in dreißigseitiger Ausbreitung interviewt. Diese Figur ist gleichzeitig eine reale Person. Daran ist im Roman gar nichts ausgedacht, was im Buch vorkommt, ist das Original-Interview. In diesem spezifischen Fall ist es sogar so, dass das Interview stark biografisch angelegt ist.
Normalerweise interessiert mich die biografische Ebene immer nur als Abfallprodukt des Anderen, was ich erzähle. Das Biografische kann manchmal eine illustrative Funktion erfüllen, aber Figuren werden bei mir nicht „entworfen“, in dem Sinne, dass ich ihre schwere Kindheit thematisiere. Wie eine Figur beschaffen ist, merke ich erst im Laufe des Schreibens. Die Figuren werden schon irgendwas, indem sie einen Drall kriegen und das resultiert aus der Rezeption von „Sachen“, also Filmen, Musik und Texten. Vor diesem Hintergrund ergibt sich dann das Alter der Figur. Es wird an einer bestimmten Stelle eine Art Inventur gemacht. Ich möchte, dass die Figuren Konturen annehmen durch die Wahrnehmungsprozesse, die ich schildere.
Würdest du deinen Schreibansatz als postmodern bezeichnen?
Ich persönlich schon. Ich merke aber immer wieder, wie wenig ich darüber informiert bin, was schon wieder neu ist. Ich lese gerade Karen Barad, die Nachfolgerin von Donna Haraway, die über Materialität schreibt. Da denke ich manchmal, dass es sich nur um einen Backlash handeln kann.
Spielst du auf das Konzept des spekulativen Realismus an, das im Roman angerissen wird?
Ja. Jedenfalls lese ich das dann und denke: „Ach, ich bin schon wieder halb hinterm Mond.“ In „Selbst“ zitiere ich eine neuseeländische Literaturwissenschaftlerin, die schreibt, dass ich ein moderner Autor in der Postmoderne sei. Sie meint, dass man nur in der Postmoderne, diese Art der Moderne, die sie meinem Ansatz zuschreibt, etablieren könne. Ich fand diesen Verweis auf die Moderne lustig, weil ich ja immer als postmoderner Autor gelte. Eine andere Zuschreibung, die gern auf mich angewandt wird, ist natürlich Pop-Literat. Das könnte ich auf meine Visitenkarte drucken lassen. Ich kann aber mit beiden Zuschreibungen leben. Dabei habe ich gemerkt, dass ich immer noch einem ganz klassischen, linken Projekt verschrieben bin. Was ich aber der Postmoderne auch attestieren könnte. Wobei es bestimmte Vorstellungen über die Postmoderne gibt, bei denen die Verbindungen zu linker Politik ausgeblendet werden. Aus dem Grunde, dass ein autonomes Subjekt negiert wird. Aber ein nicht-autonomes Subjekt, das spricht, kann trotzdem eine politische Differenzierung leisten, die dem autonomen Subjekt gar nicht zugänglich ist. Deswegen habe ich mich unter dem Begriff der Postmoderne immer ganz gut aufgehoben gefunden. Andererseits gibt es da jetzt eben diese neuen Diskurse, die ich bereits angesprochen habe und die in „Selbst“ auch mit protokolliert werden. Vor allem geht es hier um die Affekttheorie und Karen Barad, wobei letztere im Buch nicht vorkommt, weil ich sie zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht gelesen hatte. Es fällt also auf, dass sich ständig etwas bewegt, und vielleicht reden wir irgendwann nicht mehr von Postmoderne.
Thomas Meinecke liest aus seinem Roman “Selbst” 2/3
Ein Beitrag geteilt von Kaput Magazin (@kaput_mag) am
Ich hatte den Eindruck, dass es in „Selbst“ auch darum geht, eine Art sinnliche Sprache zu finden. Gelingt das denn dadurch, dass du Verschiedenes neben einander stellst? Also beispielsweise durch den Austausch zwischen Passagen, wo es ums Küssen geht – also auch auf inhaltlicher Ebene sinnlich – mit theoretischen Erörterungen. Dabei werden ja Grenzen infrage gestellt, was vielleicht eine Form von Sinnlichkeit ergibt.
Total interessant. Beim Küssen geht es ja auch immer um die Frage: Wer küsst eigentlich gerade? Geht es um den Körper, der agiert oder um die Person, mit der es gerade geschieht.
Man denkt auch an eigene Erfahrungen beim Küssen. Und die Missverständnisse, die dabei auftreten können.
Aneinanderschlagende Schneidezähne – dazu gibt es im Roman Zitate von FKA Twigs und Beyoncé. Diese Sinnlichkeit ist also auch eine abgeguckte oder ausgeborgte in Bezug auf Texte, bei denen ich sie dann finde. Ein Großteil dessen, was das direkte Interagieren von Körpern betrifft, ist bei mir von Berührungsängsten bestimmt. Es ist ja eine weit verbreitete Ansicht, dass es in der Literatur keine einzige gute Sexszene gäbe. Es wäre interessant zu überlegen, woran das liegen könnte. Ob es die Sprache ist, die dem im Weg steht oder ob es per se nur phantasmatisch codierte aus dem eigenen Leben entnommene Dinge gibt, über die die Literatur reden kann. Letzteres wird immer narzisstisch sein, auch in der Zuwendung zum Anderen. Darum geht es ja: das zu untersuchen, auch ohne Antworten zu finden. Schreiben ist in der Hinsicht immer vom Zweifel durchdrungen, ob Sprache gewisse Aspekte abbilden kann. Deswegen verwende ich auch so viele Zitate aus direkteren Zusammenhängen, die das sagen, was ich mir selber nicht gestatte.
Das kann sowohl Nina Kraviz in der Badewanne sein als auch Arbeiten des amerikanischen Künstlers Clayton Cubitt, der Frauen dabei fotografiert, wie sie beim Vorlesen ihrer Lieblingsbücher unterm Tisch masturbieren. So etwas würde ich nie selber konstruieren, aber dadurch, dass ich dieses vorgefundene Material kompiliere, kommt eine Sinnlichkeit in den Text, die ausgeborgt ist. Ich denke, dass meine Romane durchaus erotisch konnotiert sind, aber es geht eben immer auch um die Lust am Text. Ich war mir dieses Umstands selbst nicht bewusst bis ich vor Ewigkeiten auf einer Veranstaltung war, bei der Klaus Theweleit gefragt wurde, was für ihn ein erotischer Text sei, woraufhin er „Tomboy“, meinen zweiten Roman, nannte. Wir kannten uns zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, und er wusste auch nichts von meiner Anwesenheit, aber wir haben uns wegen dieses Zufalls dann kennen gelernt.
Wo siehst du konkret die erotische Qualität in deinem Schreibansatz?
Es ist natürlich nicht so, dass ich die Leute aufgeilen möchte. Ich sehe den Text eher als riesiges Feld, wo Denken und Handeln und Lust ineinander verwoben sind, so dass man gar nicht genau weiß, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Ich bin jetzt angelangt bei einem Diskurs der Zärtlichkeit, wo ich noch nie war, weil das für mich immer Begriffe waren, die sich im Besitz der Hippies befanden. Diese Terminologie war völlig kontaminiert, als ich Ende der 70er anfing zu schreiben. Damals hätte ich mich mit den Dingen, die in „Selbst“ aufscheinen, auf keinen Fall abgegeben. Das liegt aber auch daran, dass es diese interessanten neuen Theorien nicht gab, die jetzt virulent sind. Also so etwas wie die Affekttheorie, die ich noch nicht ganz begreife, bei der ich aber eine Qualität spüre, weil es vielleicht wirklich etwas jenseits der Vorstellung gibt, dass Sex / Erotik immer hierarchisch ist und in einem Knast stattfindet, der natürlich schön sein kann, etwa, wenn er von Jean Genet entworfen wird, aber es bleibt eben ein Knast. Die Affekt-Theorie versucht ja, über Foucault, Freud, Butler, die ich alle sehr schätze, hinauszuweisen, indem sie so etwas wie post-porn, post-gender, post-Sexualität postuliert. Vielleicht ist das der Weg.
Du machst ja sehr viel, also außer Romane zu schreiben. Kaput führt im Untertitel „Magazin für Insolvenz und Popkultur“. Ich habe mich gefragt, ob du von deinen Aktivitäten leben kannst. Lesungen und Symposien wirken immer sehr glamourös, aber wie sieht die materielle Seite aus?
Es ist schon so, dass ein Facharbeiter ein höheres Einkommen hat, glaube ich. Aber es ist trotzdem genug, dass ich davon leben kann. Natürlich schwankt das Einkommen auch sehr, weil ich freiberuflich arbeite. Mit Ausnahme von zwei Musiksendungen, die ich seit dreißig Jahren zwei Mal im Monat für den Bayrischen Rundfunk mache, habe ich kein festes Einkommen. Die Radiosendungen bringen ein paar hundert Euro ein, reichen aber nicht für die Miete. Vom Verkauf der Bücher könnte ich gar nicht leben, aber ohne die Bücher wären die Auftritte, die ich jede Woche irgendwo mache, nicht möglich. Da gibt es schon eine permanente Nachfrage – wobei die Orte und Kontexte sehr variieren. Das geht vom Club, wie heute hier im King Georg, über Veranstaltungen an Unis bis zu Tagungen und Panels.
Ich komme mir manchmal vor wie ein Mitglied eines umherschweifenden Podiumsproletariats. Ich trete in diesen Situationen oft nicht primär als Autor meiner Bücher in Erscheinung, sondern als öffentlicher Intellektueller. Meine Person fungiert dabei als Forschungsobjekt an Unis, aber ich werde auch zu Symposien eingeladen, wenn es um Themen geht, die in meinen Büchern eine Rolle spielen. Ich steuere dann eine künstlerische Stellungnahme zum wissenschaftlichen Ansatz bei. De facto gibt es einen intellektuellen „halo“ um meine Texte herum, die den Effekt nach sich ziehen, dass ich ständig irgendwo eingeladen werde. Zusätzlich darf ich ja sogar so berühmte Clubs wie das Robert Johnson, die Panorama Bar oder den Pudel Club bespielen. Das mache ich dann als DJ, der im Dunkeln steht und tolle, jackende House-Maxis auflegt. Und das alles zusammen ergibt meinen Lebensunterhalt.
Wenn du bei Panels eingeladen bist, bereitest du dich für das angesetzte Thema immer wieder neu vor? Wahrscheinlich bleibt ja einiges präsent, womit man sich beschäftigt hat, aber es wird bestimmt auch viel vergessen. Es gibt ein ganz schönes Zitat von Gilles Deleuze, wo er – etwas kokett vielleicht, aber egal – sagt, er sei ja kein Intellektueller, sondern Professor und müsse sich daher mit Dingen, mit denen er sich vor Jahren befasst habe, immer wieder von neuem vertraut machen. Ganz sympathisch eigentlich.
Total sympathisch, ja. Ich bin in dieser Hinsicht, glaube ich, fein raus, weil ich eben kein Professor bin und dadurch nicht dem Anspruch genügen muss, dass alles hieb- und stichfest ist. Am Anfang war es schon so, dass ich, nachdem ich mich intensiv mit Judith Butler auseinandergesetzt hatte, nachholen musste, was es vorher gab. Das führte dann zu verstärkter Kristeva-Lektüre. Als ich zu den ersten Symposien eingeladen wurde, habe ich manchmal die entsprechenden Theorietexte im Zug noch mal nachgelesen, aber das entsprach fast einer Prüfungssituation. Das mache ich jetzt nicht mehr. Im Kopf hat sich so eine Wolke gebildet, und worüber die sich abregnen wird, überrascht einen dann oft selber. Ich bin gekickt von der Idee, einfach mal rein zu gehen, wie so ein Jazzmusiker. Aber am Anfang hatte ich auch das Gefühl, man müsse sich legitimieren mit Wissen. Dabei ist Wissen ja auch Ballast. Oft will ich auf mein Wissen gar nicht zurückgreifen, aber es ist natürlich irgendwie da. So wie sich Jod in der Schilddrüse sammelt, hat man am Ende fucking Wissen.
Wird es in naher Zukunft ein neues Album von F.S.K. geben?
Ja, für das Haus der Kulturen in Berlin, ein Auftragswerk. Die Ausgangslage war dabei etwas schwierig, weil seit 2014 nur noch vom ersten Weltkrieg geredet wird. Das Haus der Kulturen will anscheinend die nächsten zehn Jahre alles, was sie machen, in Bezug setzen zum ersten Weltkrieg. Wir durften das Eröffnungskonzert geben, das auch noch am dritten Oktober stattfand, zu einer Reihe namens „Hundert Jahre Gegenwart“, aber hinter diesem Begriff verbirgt sich eigentlich schon wieder 1914 und die Folgen. Wir sind einfach nicht die Einstürzenden Neubauten, wir haben keine Lust auf Krieg. Deshalb haben wir gedacht, dass wir diesen Auftrag eigentlich gar nicht annehmen können. Dann fiel uns aber ein, dass man etwas machen könnte über die auch in heutigen Diskursen wieder oft aufgerufene Verbindung zwischen Lärm, Musik und Militär. Vor diesem Hintergrund sind wir auf Luigi Russolo gekommen, den italienischen Futuristen, der das musikalische Manifest l’arte dei rumori geschrieben und „the noise“ in die Musik gebracht hat. Unsere Arbeit ist dann zu einer Hommage an Russolo avanciert, der auch der einzige der italienischen Futuristen ist, der nicht Mitglied der faschistischen Partei war. Es gibt jetzt eine dreiviertel Stunde Musik, wobei das Meiste davon repetitiv-maschinell organisiert ist, ohne ins Brachiale oder Martialische umzukippen. In dieser Hinsicht erinnert unser Ansatz ein bisschen an Kraftwerk oder Can. Es ging uns um eine Art kubistischer, instrumentaler Rockmusik. In der Mitte gibt es eine Ballade, wo ich einen kurzen Text über Luigi Russolo singe, der aber auch Dinge streift wie „Bring The Noise“ von Public Enemy. Danach geht es dann auch musikalisch weiter mit instrumentalem Noise, und ganz zum Schluss wird ein Klavier, das in der Mitte auf einem Podium steht, von unserem Schlagzeuger mit einer Axt zertrümmert. Das war dann plötzlich nicht Zitatpop, sondern etwas, das der Idee von F.S.K. extrem entgegensteht, nämlich der Gedanke der Intensität und der Wunsch „mighty real“ zu sein, sozusagen. Aber im Zitat wurde trotzdem dieses bürgerliche Kulturinstrument zerstört, das als Äquivalent zu dem Ansinnen der Futuristen fungiert, Venedig zu fluten. Unser Auftritt ist musikalisch sehr schön aufgenommen worden vom HKB, und daraufhin haben viele Leute gefragt, ob man nicht eine Platte daraus machen könne. Martin Hossbach, der ja zuletzt auch eine Platte von Justus Köhncke rausgebracht hat, wird das Konzert auf seinem Label veröffentlichen. Wir sind weiterhin bei Buback unter Vertrag, aber diese Platte erscheint jetzt außer der Reihe. Es wird so sein, dass Scott King das Artwork macht, der ansonsten für die Pet Shop Boys arbeitet. Die Platte heißt nach einer Zeile aus einem alten FSK-Song „Ein Haufen Scheiße und ein zertrümmertes Klavier“.