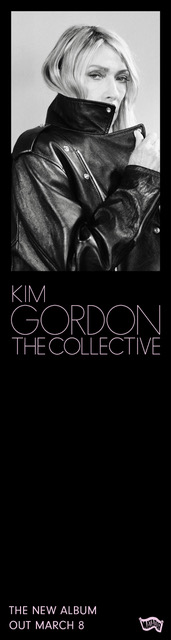King Krule / Squid
 King Krule
King Krule
“Space Heavy”
(Matador/XL)
Kann man etwas gut finden, wenn man es nur ganz selten hören will? Über diese eigentlich doch leicht zu beantwortende Frage hab ich im Zuge der Veröffentlichung von “Space Heavy” länger nachgedacht und musste also zu dem Entschluss kommen, dass ich King Krule dann wohl gar nicht so wirklich mag – aus dem simplen Grund, dass ich selten bis sehr selten Lust auf seine Alben hab.
Was ziemlich schade ist. Denn auf dem Papier klingt seine musikalische Ästhetik schon seeeehr nach meinem Ding: Ein von Beyoncé und Frank Ocean bejubelter british bloke mit einer zerschmetternden Stimme irgendwo zwischen Joe Strummer und Tom Waits, der den supercoolen Jazz von Chet Baker genauso doll liebt wie Post-Punk und die stolpernden HipHop-Beats von J Dilla, diesen ganzen Bumms dann in seinen Songs unterbringt und immer mal wieder ein fantastisches Riff schreibt, das man als Gitarrist sofort nachspielen will.
Auch auf “Space Heavy” gibt’s ein paar solcher Riffs: in der vielversprechenden Lead-Single “Seaforth”, wo jeder Ton so schön in den nächsten gleitet, sowie in “Flimsier” und “Our Vacuum”. Diese Tracks haben glücklicherweise auch würdige Gesangsmelodien, die King Krule hier überraschend seicht vorträgt, während er in den meisten anderen Nummern – und damit kommen wir zum größten Problem all seiner Platte – nur so vor sich hin zu singen scheint; auch nach mehrfachem Hören erkennt man keine spaßbringenden Muster. Was in diesen Songs dann fehlt, ist ein Song, und das wirkt dann, ich weiß wie hart das klingt, etwas lieblos. So viel also zu der Frage, warum ich nur so selten Bock auf seine Alben hab. (Ehrlich gesagt war ich beim erneuten Durchhören seiner Diskographie etwas überrascht, wie wenig Songs von ihm mir wirklich gefallen. Und wie viele lediglich an der Oberfläche meiner Ohren kratzen.)
Ein paar Punkte noch: “Hamburgerphobia” ist ein großartiger Songtitel. In eben diesem Track singt King Krule: “I think the birds want to murder me”. Ich, der eine Vogelphobie hat, kann das sehr gut nachvollziehen. “My plastic straw”, wiederholt er im Titeltrack mehrmals. Sein Plastikstrohhalm also. Die Dinger soll man doch nicht mehr benutzen.
Squid
“O Monolith”
(Warp)
Rein musikalisch ist Squid die prätentiöseste Vorzeigeband der aktuellen UK-Post-Punk-Szene, die zu großen Teilen um die Londoner Venue The Windmill kreist und in den letzten fünf Jahren immer bedeutender wurde. Während die ultra-emotionalen Süßmäuse von Black Country, New Road eher aufs Herz zielen und black midi durch ihre brutale Absurdität in erster Linie humorvoll daherkommen, sind Squid vor allem: clever. Und clevere Musik gefällt mir grundsätzlich nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Jahren, so komisch das klingen mag. Das kommt bestimmt nochmal wieder, aber momentan lässt es mich geradezu kalt, wenn ein Song (zumindest gefühlt) sieben verschiedene Parts hat, die von Ambient/Jazz-Passagen bis zu Aggro-Explosionen reichen. Too smart for it’s own good, fast so Progressive-Rock-mäßig. Damit will ich keineswegs sagen, dass Squid wie Yes klingen. Was sie aber sehr wohl tun, ist Musikstudenten-Vibes senden – und bei solchen Vibes bin ich mir gerade unsicher, ob ich sie in meinem Leben brauche.
Im Vergleich zum Debütalbum “Bright Green Field”, auf dem es noch deutlich mehr knusprige beziehungsweise “Remain in Light”-esque beziehungsweise unmittelbar einnehmende Grooves gab, ist das Squid-Zweitwerk “O Monolith” nun wesentlich schwieriger zu greifen. Sperriger ist es, und nur für ultra-aufmerksames Zuhören geeignet (überall kommen Geräusche von überall) – aber selbst im richtigen Setting macht’s nicht durchgehend Spaß: “Swing (In A Dream)” und “Undergrowth” sind auch nach mehrfachem Durchhören des Albums die einzigen Songs, die ich dir Vorsummen könnte, und liefern genügend Melodiebausteine, an denen man sich entlanghangeln kann. Andere Stellen, nun ja, langweilen. Manchmal sogar dann, wenn die Gitarren nach “Weird Fishes/Arpeggi” von Radiohead klingen. Und das tun sie sehr oft bei Squid.
Etwas schade ist außerdem, dass fast nur noch Drummer Ollie Judge zum Singen kommt und die Vokalpassagen der anderen Mitglieder deutlich zurückgeschraubt wurden. Ich lieb’s eigentlich, wenn mehrere Stimmen auf einem Album kommen und gehen und wiederkommen.