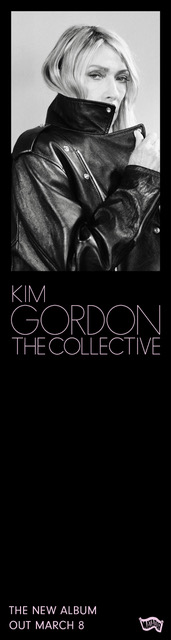„Und ich wollte noch Abschied nehmen“ – Pop, Populismus und Politik
So diffus und widersprüchlich die Antworten auf diese Frage für gewöhnlich ausfallen, so sehr sind sich die meisten der Antwort-gebenden am Ende doch einig, dass Pop am Ende meist auf der guten Seite steht: Auf der Seite der Entrechteten, Erniedrigten, auf der Seite der Unsichtbaren und Randständigen. Für die Freiheit, gegen die Obrigkeiten. Ein Essay von Luca Glenzer.
Was ist Pop?
Für die Freiheit, gegen die Obrigkeiten… Diese Vorstellung basiert auf einer langen Tradition der Popgeschichte: Sie hängt zusammen mit dem Phänomen Bob Dylan und seinem Verhältnis zu Vietnam, mit dem Aufkommen des Soul und dem Leid der schwarzen US-amerikanischen Bevölkerung, mit Disco und der Gaykultur oder dem Hip Hop und dem Elend in der Bronx. Pop war innerhalb der rationalistisch-kapitalistischen Welt ein One-Way-Ticket in die glitzernde Welt der Unvernunft, in der eigentlich unhinterfragbare Gesetze plötzlich hinterfragt werden durften, und in der der im Alltag stumm gebliebene Schrei endlich einen Resonanzraum fand.
Wenngleich Pop von der Politik nie zu trennen war, so war der kulturelle Zugang zur Welt zunächst doch ein völlig anderer: Auf der einen Seite der nüchterne, kühle, abwägende Blick der Politik, auf der anderen Seite die Ironie, die Zweideutigkeit und die übertriebene Maßlosigkeit des Pop. Was sie verband, war die Tatsache, dass das Leid der Menschen ihren Betrieb jeweils gewissermaßen aufrechterhielt. Keine Politik, wo die soziale Frage ihre abschließende Antwort gefunden hätte. Und kein Pop, wo der Alltag schon so viel Glück bereitstellt, dass die Flucht in eine utopische Welt obsolet werden würde. Wo die Politik die rationale Hoffnung auf ein zumindest etwas besseres Leben unter den gegebenen Bedingungen ist, war Pop (in seinen besten Momenten) ein großer Gegenentwurf zum Status Quo – wohlwissend, dass eine Vollendung – gar eine baldige – nur allzu unwahrscheinlich ist.
Doch wie steht es heute um das Verhältnis zwischen Pop und Politik? Wenn man den Blick auf den Bereich der deutschsprachigen Musik richtet, muss man sagen, dass es nicht zum Besten steht. Nicht, dass es heute keine subversive, auch deutschsprachige Popmusik mehr geben würde. Doch gewinnt man zwischen Chartbreakern wie Kollegah und Andreas Gabalier, Xavier Naidoo und Freiwild, Helene Fischer und Bushido den Eindruck, dass die experimentelle, progressiv-angehauchte Popmusik heute – etwas euphemistisch ausgedrückt – einen ziemlich schweren Stand hat. Damit soll hier kein Loblied auf die 70er oder 80er Jahre gesungen werden, in denen weiß Gott auch genügend reaktionärer Schund produziert wurde. Dennoch möchte ich aber die These vertreten, dass sich in den vergangenen Jahren ein kultureller Wandel vollzogen hat, der der massiven Popularisierung von (wahlweise) heimatverklärender, nostalgisierender, misogyner oder homophober Popmusik Tür und Tor geöffnet hat. Die (irgendwie auch nur entfernt) progressive Popmusik, wie ich hier einmal alles von den Talking Heads bis Lady Gaga nennen möchte, ist hingegen heutzutage eher darum bemüht, alte Freiheitsräume zu verteidigen, als neue zu erobern.
Bevor wir uns jedoch jene gegenwärtigen Tendenzen genauer anschauen, richten wir den Blick zunächst in die Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die es so möglicherweise nie gegeben hat.
„Nieder mit den Umständen, es lebe die Zärtlichkeit“: Pop und das Glücksversprechen
Es gibt zwei Möglichkeiten, über Pop zu schreiben. Zum einen als historische Abhandlung von Tatsachen, die sich streng auf die Wiedergabe von Gegebenheiten und Eckdaten konzentriert: Die korrekte Beschreibung von Produktionsprozessen, das Auflisten von Verkaufszahlen, die möglichst nuancierte Beschreibung von Sounds, und so weiter. Diese Form liefe jedoch Gefahr, allzu trocken zu geraten und damit nicht zuletzt auch dem Phänomen, das es zu beschreiben gilt, nicht gerecht zu werden. Zum Glück bleibt uns noch eine zweite Form der Auseinandersetzung: Das Schreiben über den Mythos Pop. Diese Form des Nachdenkens über Pop bezieht nicht nur das ein, was oder wie Pop tatsächlich ist oder war, sondern zugleich auch und zuallererst das, was in Pop hineinprojiziert wurde. Formen der Wahrnehmung also, die sich – wenn überhaupt – nur sehr unzureichend in Zahlen und Skalen wiedergeben lassen.
Der Mythos Pop kann als erste Minimaldefinition als das Produkt eines nur unzureichend eingelösten Glücksversprechens in der Moderne gelten. Georg Seeßlen schreibt in Anlehnung an Guy Debord, dass der Ursprung von Pop „der Verlust der Einheit der Welt“ sei. Dabei ist es unerheblich, ob es diese Einheit je gegeben hat. Wichtiger ist die Wahrnehmung, dass die Welt in viele kleine Einzelsplitter zu zerfallen droht (oder bereits zerfallen ist) und damit zunehmend einem Scherbenhaufen gleicht. So sehr der Wohlstand in der westlichen Welt gestiegen sein mag und somit die materiellen Grundbedürfnisse eines Großteils der Bevölkerung gedeckt werden konnten, so sehr herrschte doch das Gefühl der emotionalen Vereinzelung vor. Diese fand in der modernen, fordistisch-geprägten Fließbandfabrik ihren symbolischen Ausdruck: Hunderte von Arbeiter*innen auf engstem Raum, die zwar nicht alleine und doch trotzdem einsam sind, da sie der der Möglichkeit beraubt werden, in Austausch miteinander zu treten und dadurch die Vereinzelung zu durchbrechen.
Pop war für all jene lonesome hearts ein Auffangbecken. Ein Melting Pot nicht zuletzt für jene, die sich befreien wollten aus Rollenvorstellungen, die ihnen ohne persönliche Einwilligung aufgezwängt worden waren. Das Bonding-Moment von Pop war die Differenz: Indem diese nicht mehr zwanghaft abgeschafft wurde, wurde das Verschiedene zu einem großen Ganzen. Ein Ort, der versprach, dass das in der bürgerlichen Gesellschaft nur unzureichend eingelöste Versprechen der Gleichwertigkeit aller Menschen seine Erfüllung finden würde. „Im Pop waren Arbeiter- und Bürgerkinder, Männer und Frauen, Migranten und „Eingeborene“ mehr oder weniger gleich“, wie Georg Seeßlen diese utopische wie auch naive Vorstellung von Pop zusammenfasst. Pop wurde somit in der Vorstellung vieler Anhänger*innen verschiedener Subgenres zu einem Gegenentwurf jener repressiven Gesellschaft, die durch die eigene Elterngeneration exemplarisch repräsentiert wurde – und ging damit zwangsläufig Hand in Hand mit der Vorstellung, dass Pop so sehr an Fortschritt und Freiheit gekoppelt ist, wie der spießige Kleinbürger an den Schlager.
Doch der Glaube an den Fortschritt kann nur so lange existieren, wie die Vorstellung vorherrscht, dass der gesellschaftliche Zenit (des Glücks, der Zufriedenheit oder der materiellen Sicherheit) noch nicht erreicht worden ist. In dem Moment, in dem die Angst des Verlusts das Zepter der Hoffnung auf Besserung übernimmt, geraten jene, die auf eine progressive politische oder kulturelle Umgestaltung setzen, in die Defensive. Während in den 70er Jahren noch die Hoffnung überwog, dass es die eigenen Kinder irgendwann ein mal besser haben würden als man selbst, hofft man heute, dass es der Nachwuchs später nicht deutlich schlechter haben wird. Und dafür gibt es sicherlich auch nachvollziehbare Anhaltspunkte.
Doch was macht eine solche angsterfüllte Geisteshaltung mit der Popmusik? Folgt man dem Kulturtheoretiker Mark Fisher, muss man konstatieren: Sie erstarrt, denn sie wird gespenstisch. Utopische oder futuristische Entwürfe gibt es wenn überhaupt meist nur noch durch die Brille der Vergangenheit; Phänomene wie der Retrofuturismus sind Ausdruck dessen. Die gegenwärtige Ideen- und Inspirationslosigkeit wird verdeckt durch das immer wiederkehrende, eklektizistische Zusammensetzen vergangener Trends in Form einer „Simulation der Simulation der Simulation“, wie Seeßlen es nennt. Je schneller und unübersichtlicher ein belangloser Trend dem nächsten folgt, desto stärker wird dadurch das Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit und Authentizität. Ein goldenes Zeitalter für alle jene, die sich nach festen, unverrückbaren Rollen sehnen. Nach einer Zeit, in der Männer noch Männer und Frauen noch Frauen, Deutsche noch Deutsche und Sachsen noch Sachsen waren. Was ein Idyll der einen ist, ist ein Albtraum der anderen.
„In tiefsten Tiefen“: Deutschpop und Regression
Der gesellschaftliche Rechtsruck ist in aller Munde: Thilo Sarrazin und sein Verkaufsschlager „Deutschland schafft sich ab“ aus dem Jahr 2010 werden heute gern als Initialzündung betrachtet, waren aber sicherlich nicht der Anfang. 2013 bildete sich schließlich die AfD heraus, die anfangs noch Debatten darüber hervorrief, ob die Partei bloß eine stramm konservative oder doch schon eine rechtspopulistische Partei sei. Diese Frage stellt sich ob des offensichtlich rechtsextremen Charakters im Jahr 2020 niemand mehr, der nicht gerade als offizieller oder verdeckter Chefstratege im Dienste der Partei tätig ist. 2014 folgten Pegida, Legida und diverse Ableger. Die Liste ließe sich nach Belieben fortsetzen. Schmerzhaft ist diese nicht mehr zu leugnende Entwicklung nicht zuletzt für jene, die sich mit Blick auf das europäische und internationale Ausland in der – mittlerweile sehr fernen Vergangenheit – gerne damit gebrüstet haben, dass Deutschland „geläutert“ sei und „seine Lehren aus der Geschichte“ gezogen hätte. Für all die, die nun zum expliziten Feindbild der Neuen Rechten werden, ist sie ohnehin mehr als nur schmerzhaft, oft genug ist sie sogar lebensbedrohlich.
Doch während diese Entwicklungen breit diskutiert und analysiert wurden, ist häufig die Frage danach, in welchem Zusammenhang all das mit der Alltagskultur (sprich: Popkultur) steht, ziemlich kurz gekommen. Eins sei an dieser Stelle schon mal vorweggenommen: Völlig spurlos ist diese Entwicklung leider auch nicht am Unschuldslamm Pop vorbeigezogen. Um das zu explizieren, braucht gar nicht der Vorschlaghammer des militanten Nazirock geschwungen werden, der ein Nischenprodukt ist und es auf absehbare Zeit auch bleiben wird. Interessanter sind dabei vielmehr jene Kulturprodukte, die auch für die „gesunde Mitte“, die „hart arbeitende Bevölkerung“ und den „kleinen Mann“, konsumerabel sind und oft genug mit breitenwirksamen Radio-Airplays oder Prestige-trächtigen Auszeichnungen (Stichwort Echoverleihung) goutiert werden.
Während es deutschsprachige Popmusik bis auf einige Ausnahmen lange Zeit eher schwer hatte, sich gegen ihre angloamerikanische Konkurrenz im Kampf um die vordersten Chartplatzierungen zu behaupten, kann seit Anfang der 2000er Jahre eine regelrechte Renaissance des „deutschen Liedguts“ beobachtet werden. Diese Entwicklung kann nicht zuletzt auch als Ergebnis politischer Bemühungen und Interventionen rund um den Themenkomplex des „unverkrampften Patriotismus“ betrachtet werden, für den verkrampfte Patrioten von Roland Koch bis Gerhard Schröder sich in jener Zeit vehement einsetzten. Als ein kultureller Ableger jener politischen Kräfte bildete sich ab Mitte der 1990er Jahre eine Initiative mehrerer hochkarätiger, deutschsprachiger Künstler heraus, die für eine Radio-Quote deutschsprachiger Musik eintraten. Heinz Rudolf Kunze begründete sein Engagement für die Bewegung damit, dass „seit dem zweiten Weltkrieg (…) die Flut an ausländischer Musik und eben auch ausländischem Schund“ den deutschen Musikmarkt überschwemmt und deutschsprachige Künstler*innen marginalisiert habe. Die verrohte Rhetorik der Asylrechtsdebatte von Anfang der 1990er Jahre hatte ihre Spuren offenkundig auch bei sich sonst so sozialkritisch gebenden Künstler*innen hinterlassen. Und tatsächlich konnte man dann Anfang der 2000er Jahre beobachten, dass „ausländischer Schund“ zumindest in Teilen vom deutschen Musikmarkt verdrängt und durch deutschen Schund ersetzt wurde – ganz in Kunzes Sinne.
Einen ersten Vorgeschmack auf zeitgenössischen Patriotismus-Pop bot die Berliner Band MIA. Sie sang in ihrem Song Was es ist zu flippigen NDW-Retrosounds und in schwarz-rot-goldenen Outfits davon, „nicht mehr fremd in meinem Land“ zu sein, während sie „neues, deutsches Land“ betraten. „Es ist, was es ist, sagt die Liebe“ heißt es folgerichtig im Refrain, und jedem und jeder potenziellen Kritiker*in soll damit vor Augen geführt werden, dass die eigene Vaterlandsliebe kein Resultat eines bewussten Entschlusses ist, sondern ein schicksalhafter, gewissermaßen metaphysischer Akt, dessen man sich weder erwehren kann, noch will.
Während diese Form des poppigen Nationalismus sich – dem damaligen rot-grünen Zeitgeist entsprechend – zugleich bewusst integrativ gerierte und daher noch als vergleichsweise harmlose Aufwärmphase nationalchauvinistischer Träumereien gelten kann, zog eine Band wie Freiwild das Tempo regressiven Denkens deutlich an, ohne dadurch an Popularität einbüßen zu müssen. „Südtirol, du bist mein Heimatland, das Herzstück dieser Welt“ singen sie in altbekannter Pose des Herrenmenschen, und an anderer Stelle: „Ich dulde keine Kritik/ an diesem heiligen Land/ das unsere Heimat ist“, und es bedürfte schon einiger gedanklicher Verrenkungen, um Zeilen wie diese noch als Ausdruck der Überzeugung von „bestimmten konservativen Werten“ durchgehen zu lassen, wie die Band es in typisch euphemistischer Manier glauben lassen will. Sänger Philipp Burger, der sich Anfang der 2000er Jahre noch mit Hitlergruß ablichten ließ, erklärt die Band jedoch seit jeher als unpolitisch, ohne sich je eindeutig zu seiner Nazi-Vergangenheit bekannt noch sich je glaubwürdig davon distanziert zu haben. Dass die Laster der Vergangenheit mitunter schwer wiegen, wird nicht zuletzt auch in Deutschland und Österreich verstanden, und so werden der Band ihre Jugendsünden großzügig nachgesehen, wie man nicht zuletzt im Zuge der Echoverleihung 2016 sehen konnte, bei der die Band den Preis als beste Band im Bereich „Rock/ Alternative National“ einheimsen konnte. Die regressive Umdeutung des Begriffes „Alternative“ schreitet unbeirrt voran, wie auch dieses Beispiel verdeutlicht.
Doch fernab der Frage um den konkret rechtsextremen Gehalt einer Band wie Freiwild kann ihre Musik als Paradebeispiel dessen angesehen werden, was man die „Provinzialisierung von Pop“ nennen kann. Während die moderne Großstadt zum Sinnbild der Uneindeutigkeit, Entfremdung, des Multikulturalismus und des Hybriden geworden ist, verspricht die Provinz Verwurzelung, Identität, Heimat – und damit nicht zuletzt „geordnete Verhältnisse“, um mal ein geflügeltes Wort des politisch-konservativen Einmaleins zu bemühen.
Auch eine Figur wie Andreas Gabalier – erklärter Lieblingskünstler von Heinz-Christian Strache, dem gefallenen Engel der Neuen Rechten in Österreich – profitiert von der neuen Hipness der Provinz. Anders als Freiwild, die betont brachial bis militant daherkommen, versöhnt Gabalier harte Gitarren und Discobeats, sowie den Rebellen mit dem Liebling aller Schwiegermütter und ist so zum wohl erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersänger aufgestiegen. Er steht exemplarisch für eine neue Generation Popstars, die durch einige formale Erneuerungen das reichlich eingestaubte Bild des Schlagersängers aufpoliert haben, ohne die altbekannte inhaltliche Ödnis und Regression auch nur im Entferntesten zu überwinden. Dementsprechend singt er in seinem Lied Mein Bergkamerad (in hochdeutscher Übersetzung von Jens Balzer): „Kameraden halten zusammen ein Leben lang/ eine Freundschaft, die ein Männerleben prägt/ wie ein eisernes Kreuz (sic!), das am höchsten Gipfel steht/ und selbst dem allerstärksten Sturmwind widersteht.“. Auf der Bühne moniert er schon mal, dass man es heute „nicht leicht auf dieser Welt [habe], wenn man als Manderl noch auf Weiberl steht“. Doch um ja nicht missverstanden zu werden, betont er an anderer Stelle, nichts gegen Schwule an sich zu haben, nur müsse man dies (also schwule Sichtbarkeit) „nicht ganz so breit in der Öffentlichkeit austreten (…). Aus Respekt unseren kleinen Kindern gegenüber.“ – ein rhetorischer Kniff rechtspopulistischer Art, wie er im Buche steht.
Hingegen stellen jene Textzeilen, in denen etwa ein Xavier Naidoo in der Vergangenheit Homosexualität implizit mit Pädophilie in einen Topf geworfen hat (wie es in seinem Track „Wo sind sie jetzt“ aus dem Jahr 2012 geschehen ist), angesichts seiner rechtsesoterischen Radikalisierungstendenzen innerhalb der letzten Jahre noch eine vergleichsweise milde Form der Verdummung dar. Egal ob es um die Leugnung des Klimawandels, die vermeintliche Frühsexualisierung von Kindern, sogenannte „Deutschlandfeindlichkeit“ oder wie vor kurzem die Verbreitung des Qanon-Glaubens geht: Naidoo beherrscht die Klaviatur faschistoider Mobilmachung inzwischen perfekt und weiß viele seiner treuen Fans nicht trotz, sondern wegen seiner vielen Skandale hinter sich.
Dabei stellt er gegenwärtig einen Brückenkopf dar zwischen nationalchauvinistischen Vertreter*innen wie Freiwild und dem deutschen Gangsterrap der Sorte eines Kollegah, der sich gleichermaßen durch misogyne wie verschwörungsideologische Phrasendrescherei auszeichnet. Letzteres Phänomen verdeutlicht, dass nicht nur in den Bekenntnissen zur Provinz zur Zeit regressive Tendenzen ungeahnten Ausmaßes erwachsen, sondern auch die Urbanität ein Einfallstor chauvinistischer Machokultur darstellt. Und auch wenn beide Phänomene – deutschnationaler Schlager und Breitbeinrock auf der einen, chauvinistischer Gangsterrap auf der anderen Seite – in den meisten Abhandlungen über die zeitgenössische Popkultur sorgsam getrennt analysiert werden, so gibt es doch berechtigten Anlass zu der Annahme, dass möglicherweise beide Phänomene mehr miteinander gemein haben könnten, als ihnen jeweils lieb sein mag.
Ghettorap und Heimatrock: Zwei Seiten, eine Medaille?
Eines jener Attribute, das jeder Gangsterrapper (an dieser Stelle wird bewusst nur von Männern gesprochen) wie eine Trophäe stolz vor sich herträgt, ist es, „kein Blatt vor den Mund“ zu nehmen. Und in diesem Punkt muss man dem Gros jener Vertreter wohl bescheinigen, ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Während sich ein rechtstümelnder Schlagerstar wie Gabalier noch an gewisse rhetorische Gepflogenheiten zu halten hat (auch wenn die Grenzen des sogenannten „Sagbaren“ in den vergangenen Jahren peu à peu nach rechts verschoben wurden), um den Anschluss an die bürgerliche Mitte nicht zu verlieren, profitiert der deutsche Gangsterrap gerade davon, diese Gepflogenheiten nicht nur zu ignorieren, sondern sie auch bewusst zu verletzen.
Als einer der ersten Gangsterrapper trat im Jahr 2002 ein gewisser Rapper namens Bushido in das Licht der Öffentlichkeit. Mit Zeilen wie „Scheiß auf Beziehung, jede Frau ist eine Hure/ Frauen schreien, wenn ich ihr Arschloch ficke/ Halt dein Maul, sonst gibt’s gleich ne Schelle/ Mach was ich dir sage und zick mir nicht rum/ Leg dich hin und nimm mein Schwanz in den Mund“ prägte er eine ganze Generation pubertierender Jungs. Neben Frauen wurden selbstredend auch alle Schwulen zu Bushidos Zielscheibe, etwa wenn er im Stück „Berlin“ rappt: „Berlin wird wieder hart, denn wir verkloppen jede Schwuchtel“. Einige Jahre später, im Jahr 2011, dankte man ihm seinen Dienst an der Jugend im Rahmen der Bambiverleihung mit dem Integrationspreis. Offensichtlich konnte kein besserer Brückenbauer als Bushido gefunden werden. In der Zwischenzeit hatte er es erfolgreich geschafft, der Öffentlichkeit zwei Seiten seiner Persönlichkeit zu präsentieren: In den deutschen Feuilletons gab er sich als sensibel, nachdenklich und gemäßigt, seiner Anhängerschaft weiterhin als brutaler Macho. Wie eine gesellschaftlich gezähmte und vergleichsweise harmlose Version Bushidos aussieht, offenbarte er in einem Interview mit der Welt am Sonntag im Jahr 2005, als er zu seinen persönlichen Vorstellungen bezüglich des Geschlechterverhältnisses befragt wurde: „Ich bin schon für Gleichberechtigung, aber es gibt trotzdem Sachen, die muss eine Frau machen, und es gibt Sachen, die ein Mann machen muss. Natürlich kann ich auch kochen, aber wenn eine Frau im Haushalt ist, dann sollte sie es übernehmen, weil es eine Tätigkeit ist, die ihr näher liegt“.
Während in den ersten Jahren des deutschen Gangsterrap noch etwaige homophobe und sexistische Aussagen den Kern des inhaltlichen Problems ausmachten, gesellten sich in den vergangenen Jahren mit Künstlern wie Farid Bang und Kollegah zunehmend verschwörungstheoretische und antisemitische Inhalte hinzu, ohne dass freilich ersteres verschwunden wäre. Stellvertretend dafür sei der Song „Apokalypse“ von Kollegah aus dem Jahr 2016 genannt, der im dazugehörigen Video nichts weniger als die Geschichte der Menschheit in Form des altbekannten Kampfes Gut gegen Böse zu erzählen versucht. Das Böse wird in Form einer Satansfigur dargestellt, die – Zufall? – mit einem Davidstern auf der Stirn versehen wurde – der Jude als ewiger Störenfried. Am Ende jedoch wird das Böse (ergo der Jude) besiegt, und „Christen, Muslime und Buddhisten“ bauen die Welt wieder neu auf, dieses Mal freilich in friedlicher Absicht.
Im Kontext der medialen Verhandlung dieser Thematik ist immer wieder zu beobachten, dass versucht wird, die Brutalität des Gangsterrap zu relativieren, indem auf die schwierigen sozialen Verhältnisse verwiesen wird, denen vieler der heute erfolgreichsten Gangsterrapper fraglos entspringen. Dabei ist es natürlich wichtig, im Sinne einer kritischen Gesellschaftstheorie Popmusik nicht als Produkt innerhalb eines luftleeren Raumes zu betrachten, sondern soziale Missstände und Ausgrenzungserfahrungen als Motor einer verrohten Kultur zu begreifen und mit einzubeziehen – nicht zuletzt, um zukünftig eine möglichst nachhaltige Präventionsstrategie zu entwickeln, die einer derartigen Verrohung entgegenwirkt. Andererseits läuft eine solche Herangehensweise schnell Gefahr, nicht Verständnis von, sondern Verständnis für die Verrohung zu entwickeln, sie dadurch moralisch zu entschulden und somit die Handlungsträger*innen jener Kultur nicht mehr als mündige Subjekte zu begreifen, sondern als starres Produkt ihrer jeweiligen sozialen Herkunft und Erfahrungen. Es kommt also darauf an, zwischen notwendiger soziologischer Analyse und der moralischen Bewertung entsprechender Kulturprodukte zu unterscheiden.
Jens Balzer plädiert daher dafür, sowohl urbanen Gangsterrap als auch den zeitgenössischen Heimatrock als „getreuen Spiegel einer entfesselten Wettbewerbsgesellschaft“ zu begreifen. So sehr sich die kulturellen Codes beider Phänomene unterscheiden, so sehr ähneln sie sich in ihrer bornierten Vorstellung einer Gesellschaft, in der monolithisch voneinander abgegrenzte Gruppen um die Vorherrschaft der kulturellen Hegemonie konkurrieren. Pluralismus, Abweichung, Kritik, Uneindeutigkeit, Differenz – all jene Attribute haben in einer Gesellschaft, in der das Recht des Stärkeren gilt, keine Perspektive mehr. Identität – die in den besten Momenten der Popmusik transgressiert und damit veruneindeutlicht wurde – wird so zum kulturellen Anhaltspunkt, der der eigenen Selbstvergewisserung dient. Fragen werden nur noch in rein rhetorischer Absicht gestellt – und Antworten in Form unumstößlicher Wahrheiten präsentiert und gefeiert.
Geschichte wird gemacht, es geht zurück
Trotz all der niederschmetternden Ausführungen ist zweifellos nicht gesagt, dass emanzipativer Pop als solcher am Ende ist. In vielen Segmenten des Popfeldes ist im Gegenteil ein durchaus wacher und kritischer Blick bezüglich reaktionärer Tendenzen zu beobachten: Für den Bereich des Deutschrap können dafür exemplarisch etwa die Antilopen Gang oder Sookee herangezogen werden, die sich nicht nur im Allgemeinen politisch äußern, sondern sich auch explizit auf immer wiederkehrende Ausfälle im Gangsterrap beziehen und diesbezüglich Aufklärungsarbeit leisten. Campino, Frontmann der viel gescholtenen Toten Hosen, hat mit seiner Wutrede im Rahmen der Echoverleihung 2018 an Kollegah und Farid Bang jene Sprachlosigkeit und Mentalität des Schweigens durchbrochen, die bei den übrigen Anwesenden an jenem Abend vorherrschte. Auch das Kosmos-Festival, das von etlichen Aktivist*innen nach den rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz im Frühsommer 2019 unter dem Banner #wirbleibenmehr organisiert wurde und so unterschiedliche Interpret*innen wie Zugezogen Maskulin, Tocotronic und Herbert Grönemeyer aufbieten konnte, war ein deutliches Statement, dass faschistische Tendenzen von einer Vielzahl deutscher Kulturschaffenden nicht einfach so hingenommen werden. All dies verdeutlicht aber auch: Es geht gerade vielfach um das Bewahren bereits existierender, nicht um den Zugewinn neuer Freiheiten.
Zudem muss hinzugefügt werden, dass ein Bekenntnis gegen militante Nazistrukturen wohl nahezu allen Künstler*innen der bürgerlichen Mitte leicht über die Lippen geht – aus publicity-Sicht kann man damit schließlich nicht viel falsch machen. Bei offen verschwörungstheoretischen und reaktionären Künstler*innen wie Xavier Naidoo wurden hingegen über viele Jahre immer wieder alle nur erdenklichen Augen zugekniffen, um nicht realisieren zu müssen, was offensichtlich war. Stellvertretend dafür sei das breite Solidaritätsbündnis „Menschen für Xavier Naidoo“ zu nennen, das sich im Jahr 2015 zusammenfand, um nach der ESC-Ausladung für Naidoo Partei für ihn zu ergreifen. Dem Bündnis schloss sich in bemerkenswerter Geschlossenheit die Sperrspitze der deutschen Pop-Avantgarde an – von Tim Bendzko bis Yvonne Catterfeld, von Samy Deluxe bis Andreas Gabalier, von Silly bis Christina Stürmer, von Roger Cicero, Jan Delay, Die Prinzen und Pur bis Farid Bang durfte oder wollte kein deutsches Popsternchen fehlen. Und das in einer Zeit, in der Naidoo wiederholt von einer „Deutschland GmbH“ gesprochen hat, vor Reichsbürger*innen aufgetreten war, in seinen Songs vor „Totschilds“ gewarnt hatte oder Homosexualität mit Pädophilie in Verbindung gebracht hatte, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Dies offenbart, wie brüchig die viel beschworene Brandmauer nach rechts tatsächlich ist und wie sehr immer wieder versucht wird, wahlweise antisemitische, sexistische oder homophobe Äußerungen mit dem Verweis auf die Meinungsfreiheit relativieren zu wollen.
So viel ist klar: Die Vorstellung, dass Pop für die Befreiung aus unterdrückten Verhältnissen, für die Emanzipation marginalisierter Gruppen steht, ist längst als Mythos entlarvt. Wenngleich er immer ein Konglomerat aus progressiven und regressiven Tendenzen dargestellt hat, so waren letztere vielleicht noch nie so wirkmächtig und lautstark, wie es gegenwärtig zu beobachten ist. Und damit ist auch klar: Es geht eben nicht immer nur voran, wie die Fehlfarben einst (mit einem oft unbemerkten Augenzwinkern) gesungen haben; manchmal stagniert die Geschichte, und manchmal versucht sie sich auch in einer Rolle rückwärts. Eigentlich ja logisch, wenn man bedenkt, dass Pop oder im weiteren Verständnis die Kulturindustrie vielleicht das unmittelbarste, ungeschönteste Spiegelbild der Gesellschaft darstellt – im besten, aber eben auch im schlechtesten Sinne.
TEXT: Luca Glenzer