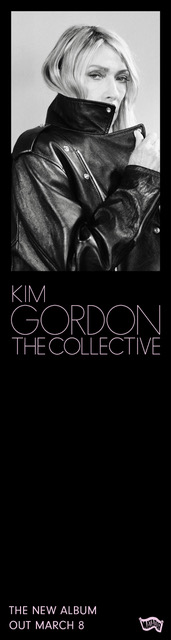Die urmenschliche Angst vor den eigenen Abgründen
Cannibal, die gemeinsame Band von Cary Loren, Dennis Tyfus und Cameron Jamie, vereint drei singuläre Künstlerbiografien mit deutlichen Musikbezügen.
Cary Loren gehörte mit Mike Kelley, Jim Shaw und Nigara (Lynn Rovner) zu jener Gruppierung junger KünstlerInnen, die 1973 an der University of Michigan die Art-School-Band Destroy All Monsters gegründet hat. In seinem “Manifesto of Ignorance; Destroy all Monsters” spricht er davon, mit Destroy All Monsters eine “Menagerie aus Wörtern, Bildern und Tönen” aufgefahren zu haben, um dem ur-männlich geprägten US-Rock der 70er Jahre eine andere Geste entgegen zu halten. Eine, die offen für Zweifel und Sehnsüchte war. Eine, bei der alle Beteiligten nicht immer (wenn denn jemals) wussten, wo sie sie hinführen würde. Man verstand sich in der Tradition von freien Jazz-, Rock- und Avantgardegeistern wie Sun Ra, Captain Beefheart und den Silver Apples, negierte aber auch nicht den Rock von Stooges oder MC5 (zu den späteren Mitgliedern gehörten Ron Asheton von den Stooges und Michael Davis von MC5). Die Shows erinnerten an das Theater Grand Guignol und waren kurze, blutige, anarchisch-apokalyptische Ausbrüche, bei denen alles möglich war.
Dennis Tyfus, der mit bürgerlichen Namen Dennis Faes heißt, betreibt in Antwerpen das Ultra Eczema Studio. Als Kind der 80er Jahre repräsentiert er einen für diverse Ausrichtungen offenen Künstlertypus. Tyfus arbeitet mit völliger Selbstverständlichkeit ebenso als Illustrator und Veranstalter wie als Bildender Künstler, Radiojournalist und Musiker – letzeres gleich unter einer Vielzahl an Solo-Aliasen (Bitchy Vallens, Herr Keula, Penis Tea Flush, Vom Grill) und in drei Bandkonstellationen (neben Cannibal sind dies noch Call Gypsi und Speedqueen). Kein Bereich ist ohne den anderen denkbar, die künstlerische Praxis ein Spinnennetzartiges Gebilde, in dem alles für alles Bedeutung in sich trägt.
Der in Los Angeles Ende der 60er Jahre geborene und derzeit in Paris lebende Cameron Jamie stellt sozusagen das Schanier zwischen den Generationen dar bei Cannibal. Die generelle Abeitsweise von Jamie (der übrigens von John Sinclair gemanagt wird, dem, früheren MC5-Manager) als Multimedia- und Performancekünstler ist einerseits bereits geprägt von den zeitgemäßen digitalen Möglichkeitsräumen, seine Herangehensweise aber noch deutlich konzentrierter als bei jüngeren Vertretern der postdigitalen Kunst. Mit seinen Arbeiten untersucht Cameron Jamie inwieweit geografische und tradionelle Festschreibungen den Alltag von Menschen zu prägen vermögen. Er hinterfragt die Ablenkungsprojektionsmechanismen von Gesellschaften und ihren Mitgliedern und den diesen anhängigen Schattenwürfe. Seine filmischen Dokumentationen sind karge, direkte Einblicke in eine Welt der Sinnsuchenden Begierde. Hierfür arbeitet er sehr intensiv mit der Musik als Stilelement, zu seinen Kollaborateuren gehören dabei unter anderem die amerikanische Avantgarde-Rock-Band The Melvins und der japanische Free-Noise-Musiker Keiji Haino.
Bis dato gibt es zwar nur einen Tonträger von Cannibal, “Cannibal” (dessen Silkscreen-Cover von Cameron Jamie gestaltet wurde), der Referenzkosmos, den die drei Protagonisten damit aufmachen, beweist jedoch bereits eindrucksvoll, dass man Cannibal in der Traditionslinie des von Mayo Thompson Mitte der 60er Jahre gegründeten Avantgrade-Rock-Kollektivs Red Krayola und Lorens Band Destroy All Monsters lesen darf.
Über den Verlauf der fünfzehn Songs (die teilweise die charakterlichen Züge von Skizzen und Interludes tragen), die 2010 von Loren, Tyfus und Jamie in Antwerpen aufgenommen wurden und in aller Abgehangenheit erst drei Jahre später in Detroit von Warn Defever and Cary Loren abgemischt wurden, entwickelt sich ein chaotisch anmutender Strudel der Gefühle. Es ist ein Chaos, dessen narrative Stringenz sich jedoch einstellt, wenn man die Angst vor der Desorientierung erst einmal abgelegt hat. Inspiriert von White Trash und Horror (Anti-)Ästhetiken zelebrieren die drei einen wilden ekastischen Ausbruch zwischen freier Improvisation und akzentuierter rhythmischer Signifikanz.
Es ist eine zugleich abstoßende wie auf eigentümliche Art und Weise klebrig anziehende Mischung, die Cannibal da auf uns loslassen. Symbolisch auf den Punkt gebracht in ihrem Song “Sweet Dreams”, in dem aus dem bösen und düsteren White Noise plötzlich manisch vorgetragende Stimmfetzen greifbar werden, deren einzelne, Wortähnliche Gebilde sich peu a peu in unseren popkulturell geschulten Köpfen als Fragemente von “Sweet Dreams (are made of this)” von der britischen 80s-Pop-Gruppe Eurythmics zusammenfügen:
“Who am I to disagree … I travel the world and the seven seas … Everybody´s looking for something … Sweet Dreams … “
Transmission Interruptions.
Schlaglöcher der Existenz.
Der ganz normale Wahnsinn.
Der Bandname selbst, also der Verweis auf den Kannibalismus, spielt natürlich mit der urmenschlichen Angst vor den eigenen Abgründen. Der Vorstellung von seinesgleichen gegessen zu werden, haftet ja zugleich die Frage an, was es bedarf, dass man selbst einen Menschen essen würde? Wenn Cannibal einen Song „Phantasm“ nennen, dann nicht, um es uns einfach zu machen und alles als reines Hinrngespinst, als Sinnestäuschung und Produkt unser Fanatsie zu dekonstruieren, sondern um den inneren Vertigostrudel noch eine Ebene weiter um sich selbst herum zu treiben.
Das Grauen schleicht sich in „Phantasm“ (und in vielen weiteren Stücken von Cannibal) wie in einem japanischen Horrorfilm an: nicht als leise Ahnung des Bösen wie im europäischen Kino, sondern mit der vollen Wucht des omnipräsenten und unausweichlichen Terrors. Die Länge von 2 Minuten gibt es bereits vor: in diesem Stück gibt es keinen Ort und keine Zeit für falsche Hoffnungsfährten. Warum sich noch Illusionen hingeben, wenn doch das Tick und Tack des Lebens in seiner konsequenten Endlichkeit allen bewusst ist. Und so quitscht und klopft und schreit es aus den Eingeweihten – und am Ende frisst sich der Schrei langsam selbst, ganz so wie der Mensch den Menschen in bester Fassbinder Manier noch immer klein gekriegt hat.
In diesem Sinne: alles ist hörbar, nichts ist sicher. Cannibal spielen mit offenen Karten und dem vollen Bewusstsein dafür, dass auf Erden nichts düsterere Abgründe zu bieten hat als die menschliche Existenz.
Wir dürfen gespannt sein, wie uns die Gruppe Cannibal all dies und noch viel mehr im Kölnischen Kunstverein darzubieten gedenkt.
Cannibal live:
Kölnischer Kunstverein, Samstag, 16. April 2015, 20.30 Uhr