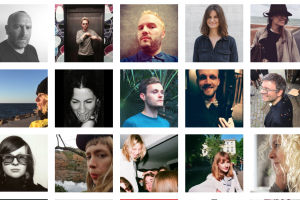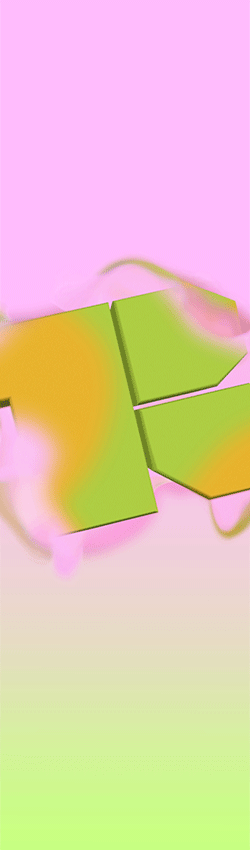Tina Heine: „Wir müssen weg von dieser Wettbewerbs- und Wachstumslogik in der Kunst!“
Viele Menschen scheitern daran, dass sie zu lange über die Dinge nachdenken und deswegen oft gute Ideen verpuffen. Nicht immer, aber auch nicht selten ist Handeln eine gute Option zum Stillstand des zu lange Nachdenkens. Tina Heine, das wird bei einem Blick auf ihre Biographie schnell deutlich, vereint in sich Neugierde und Leidenschaft. Statt in das Zuhören und Reden in Universitätssälen steckte sie ihre Energie lieber früh in die Hamburger Nächte und die HADLEY´s Bar und schuf so einen Ort für den Kulturaustausch, einen Ort mit fließenden Wänden, der mutige Fragen zuließ. Warum nicht die Bar auch ohne perfekte Anlage und richtige Bühne zum Jazz Club machen?
Der Erfolg der von ihr etablierten (Jazz-)Montage sollte ihr Recht geben – und noch mehr die Menge an begeisterten BesucherInnen. Eine Initialerfahrung, die zur Gründung des ELBJAZZ Festivals führen sollte, das Tina Heine sechs Jahre lang mitführte, bevor sie die Geschäfte ihren Investoren und Mitgesellschaftern FKP Scorpio und Karsten Jahnke überließ und nach Salzburg ging, um die Leitung des Jazz & The City Festival zu übernehmen.
Genau diese Offenheit für andere Menschen und Orte zeichnet auch den Weg von Tina Heine zum SUPERGAU aus. Eigentlich traf sie ihren Ko-Kurator Theo Deutinger in einem Salzburger Cafehaus nur, um die Person hinter dem „Handbook of Tyranny“ näher kennenzulernen, schnell wurde aus persönlichen Interesse aber ein gemeinsamer Nährboden für Ideen und die beiden bewarben sich auf die Ausschreibung für ORTUNG (ein Festival für zeitgenössische Kunstproduktionen im Salzburger Land), bekamen den Zuschlag und macht es zu ihrem gemeinsamen SUPERGAU, dem Festival für zeitgenössische Kunst, das aktuell bis zum 24. Mai noch in Flachgau, Salzburg stattfindet.
Tina, was suchst du generell in der Kunst und in der Musik? Was kannst du nur dort finden?
Das „um die Ecke denken“, den Austausch, das Ausprobieren, das Kollektive, das Internationale, das losgelöst sein von 8-5 Arbeitszeiten, das Prozesshafte, den freien Fall, die Stimmung, das Gastgeberin sein, das Rumspinnen, die vielen klugen Menschen, das poetische, das Laute und das Leise
Wenn ich mir die Liste deiner Vorträge anschaue, so spricht aus dieser deine Neugierde für sehr unterschiedliche kulturelle Orte und Themen, da geht es um Jazz & Politik, um Kunst & Moral, um Gärten, um kreatives Denken, um Improvisation, um Gender… Kannst du ausmachen, was all deine Interessen eint?
Ich glaube der unbedingte Wille zum Gestalten, des gesammelte Wissen teilen und reflektieren zu wollen, Fragen zu stellen und die Lust auf Menschen, Gemeinschaft und Teilhabe.
Die Pandemie hat für uns alle die reale Welt massiv verkleinert. Was per se nicht von Nachteil sein muss, da so die lokalen kulturellen Zusammenhänge, die ja qualitativ den globalen in nichts nachstehen müssen, in den Vordergrund geraten. Ein gutes Beispiel dafür ist der SUPERGAU mit seinen 19 Orten. Tina, wie hast du selbst diesen Prozess im vergangenen Jahr wahrgenommen?
So ganz kann ich dem nicht zustimmen. SUPERGAU ist ja konzeptionell vor Corona entstanden und sollte natürlich auch vom internationalen Austausch über unsere Kernthemen (unter anderen zeitgenössische Kunstproduktionen und -rezeptionen in ländlichen Gebieten) leben. Wir hatten über 300 Einreichungen aus aller Welt – von Italien über Kazan bis hin nach Brasilien. Mich hätte sehr interessiert, wie aus den anderen Regionen der Welt (oder ob überhaupt) ein Thema daraus gemacht würde.
Dann kam uns der erste Lockdown im Frühling letzten Jahres in die Quere und schnell war uns klar, dass das Festival auf sichereren Beinen steht, wenn wir KünstlerInnen maßgeblich aus Österreich, vielleicht noch Deutschland und der Schweiz etc. einladen. So sind wir jetzt natürlich anders aufgestellt. Auch das hat seine spannenden Seiten – insofern hast Du natürlich schon auch Recht: sich reduzieren/eingrenzen zu müssen, das bringt auch eine gewisse Form der Konzentration mit sich.
Ich habe über das letzte Jahr gelernt, mich von geliebten Vorstellungen flexibler zur verabschieden und in Alternativen zu denken – mit der Herausforderung darin dann neue Leidenschaften und neue Fragen zu entdecken. Auch hat das nicht wirklich planen können, hat schon einen enormen Reiz, denn es ist eine grandiose Entschuldigung für alles, dass was man gern offen lassen möchte.
Wie hat dieser Prozess sich auf deine Arbeitsweise ausgewirkt?
Ich merke, dass ich Raum und Zeit noch offener denken muss als ich das eh schon tue. Und ich sehe es als eine Chance andere, denen das bisher schwer fällt, mit auf diese Reise zu nehmen.
Ich genieße es ja total, wenn ich heute nicht schon wissen muss, wer im Oktober auf meinem Jazzfestival (Jazz & The City) spielt, oder dass wir mit den SUPERGAU KünstlerInnen Rahmenprogramm entwickeln können, das dann sehr auf Improvisation baut. Insofern entspricht manches der aktuell geforderten Arbeitsweise sowieso meiner Haltung, ohne dass ich sie so viel erklären muss wie sonst, wenn ich in meinen Programmen weiße Felder/blind Spots habe.
Das war die Optimistin und Spielerin in mir. Ansonsten? Ich finde die aktuelle Lage schon extrem fordernd und auch kritisch. Auch fehlt mir das „jagen und sammeln“, das zufällig auf Menschen und Themen treffen, der Austausch im Kaffeehaus oder an der Bar. Das ist mein „modus operandi“ – und der ist gestört.
Dass die Häuser (Theater, Konzertsäle, Clubs) geschlossen sind, ist schlimm, aber selbst das wäre ja unter Umständen durchaus mal eine Chance um unser System neu zu denken oder zu reflektieren. Aber wie sollen wir das tun, wenn wir nicht zusammensitzen dürfen, wenn es gar keine Orte des informellen Austauschs und des Ausprobierens mehr gibt?
Diese Reduktion von sozialen Kontakten auf mehr oder weniger den eigenen Haushalt ist kritisch und verhindert natürlich auch das kritische Neudenken und mehr aus dieser Zeit machen zu können. Gleichwohl verstehe ich, dass das wohl so sein muss. Es ist ein Dilemma.
Denkst du, dass diese Veränderungen nachhaltiger Natur sind?
Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir in diesen zwölf Monaten öfter hätten zusammensitzen können – ohne Aufführ-Druck, ohne Events etc., aber mit Wein, Bier und guten Leuten –, dann hätte sich so manches entwickeln lassen können. So bleibe ich etwas skeptisch, habe aber den unbedingten Willen bei mir selbst anzufangen und das, was so durch meinen Kopf geht auch konkret anzugehen und so andere zu inspirieren, sowie mich von anderen und ihren Gedanken inspirieren zu lassen.
- Supergau
- Momentaufnahmen
- Photos. Tina Heine
Wenn man sich durch die Doku-Sektion auf der SUPERGAU-Website bewegt, fällt einem die Grenze zwischen Vor-Corona-Ereignissen in 2019 und den Künstlerresidenzen während der Pandemie nicht wirklich auf. Man muss schon sehr genau hinsehen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass SUPERGAU für den öffentlichen Raum konzipiert ist. Und doch bin ich mir sicher, dass es Auswirkungen auf deine Arbeit hatte. Welche?
Schön, dass Du das sagst. Natürlich hatten wir mit unserer reinen Außenformat-Konzeption und der Weitläufigkeit die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir trotz Corona arbeiten können. Aber natürlich hat das einiges verändert. Theo Deutinger und ich hatten die Phase vor dem Festival viel interaktiver und offener gedacht, die Künstlerresidenzen vor Ort im Flachgau im September und im März sollten mit Kochen, Treffen mit Vereinen und BürgermeisterInnen, mit gemeinsamen Exkursionen und mit mehr Austausch und Zusammenarbeit zwischen den KünstlerInnen sowie langen Nächten mit Endlosdiskussionen statt finden. Auch planten wir einen Camping Campus während des Festivals – eine internationale, Open-Air-Freestyle-Universität, wo Lernen ganz anders gedacht ist – aber auch das ist mit dem limitierten Reisen, dem teilweisen Verbot von Präsenzunterricht und Exkursionen natürlich sehr schwer umzusetzen.
Inwieweit hat sich die Zusammenarbeit mit den involvierten KünstlerInnen verändert?
Sie war von Beginn an erschwert und entbehrt diese Unbefangenheit und auch tatsächlich körperliche Nähe, die sich sonst bei den Zusammenkünften ergibt. Auch ist für manche KünstlerInnen das Anreisen extrem erschwert wegen Quarantäne.
Du betreibst in Hamburg seit mehr als zwanzig Jahren die Bar HADLEY’S – was hat dich die Kultivierung eines solchen sozialen Biotops gelehrt für deine weitergehende Kulturarbeit?
Vieles. Vielleicht am prägendsten das Wissen um die Notwendigkeit von guten, vertrauensbildenden Orten, an denen man auch mit „Fremden“ eine richtig gute Zeit haben kann.
Der Musiker und Stadtplaner Christopher Dell hat mal über mich gesagt, dass ich es beherrschen würde, den „perfekten Hang“ zu schaffen, an dem die „Cats“ dann zusammenkommen und Dinge denken und erschaffen, die eben nur durch diese Atmosphäre überhaupt erst ermöglicht werden.
Ich denke, dass gute Gastgeberschaft wichtig ist, auch im übertragenen Sinne: es geht darum, sich für andere zu interessieren, ein offenes Ohr zu haben und dafür zu sorgen, dass sich die anderen wohl und gesehen fühlen. Und dass sie Dir vertrauen und immer wieder kommen. Das macht total frei in der eigenen Kreativität und zugleich hat man die Themen der anderen mit im Blick.
Zum Thema Biotop: es ist fantastisch wie sehr sich räumlich begrenzte Erfahrungen (ab einer gewissen kritische Masse) auf das große Ganz übertragen lassen.
Tina, wie gehst du an deine kuratorische Arbeit heran? Wie hat man sich die Programmgenese als Prozess aus singulären künstlerischen Positionen und dem Makro-Dialog dieser vorzustellen?
Das ist ein bisschen wie freier Fall. Ich freue mich, dass Theo und ich da eine gemeinsame Sprache gefunden haben – ich muss ja noch einmal daran erinnern: wir zwei kannten uns nicht. Wir haben nach einem zweistündigen Austausch im Cafe beschlossen uns gemeinsam zu bewerben und kamen dann direkt ins Arbeiten.
Es ist großartig, dass Theo so direkt ist, so unverstellt und auch irgendwie ähnlich gelassen und zuversichtlich wie ich, wir beide sind auch Improvisateure und nicht so gebunden an die Erwartungshaltung anderer. Wir waren uns bewusst, dass wir nicht aus dem Kunstsystem kommen und so wahrscheinlich eh lauter „Fehler“ machen würden. Das macht ziemlich frei. Wir sind ohne einen Plan an die Ausschreibungen des Open Calls herangegangen.
Wir haben die KünstlerInnen aufgefordert, neue Wege zu gehen mit diesem Festival, inhaltlich, aber auch räumlich gesprochen durch die zur Verfügung stehenden 1000 Quadratkilometer Flachgau als Festivalgelände. Auch uns selbst wollten wir fordern. Eine Jury hat die Arbeiten ausgewählt, wir waren Teil der Jury hatten aber nicht mehr Stimmanteile, so war völlig offen, welche Arbeiten und wo diese Arbeiten stattfinden würden.
Daraus ein „Gesamtwerk“ zu machen, diesen Ambition haben wir gemeinsam mit den KünstlerInnen in den Residenzen entwickelt. Das ist ein toller Prozess für alle –denn selten sind KünstlerInnen so sehr eingebunden in den Entstehungsprozess und die Produktion eines Gesamtfestivals. So denken viele aus unterschiedlichen Perspektiven mit.
Einer der Ankerpunkte im Supergau war unsere Idee, das Thema Mobilität bei der Produktion in den Mittelpunkt zu rücken – denn immerhin pendeln 70%der Flachgauer täglich nach Salzburg in die Stadt! Das außer Acht zu lassen, wäre eine vertane Chance gewesen, das sahen auch die KünstlerInnen so. So entstand die Idee, das Festival entlang der beiden großen Buslinien 120 und 150 stattfinden zu lassen, die den Flachgau maßgeblich mit der Stadt Salzburg verbinden – vom Wolfgangsee im Südosten bis hin zum Mattsee und Obertrumer See im Nordwesten. Man kann also alle Arbeiten mit den Linienbussen abfahren/erreichen.
Themen wir Nachhaltigkeit, Stadt/Land-Gefüge, Digitalisierung und die Befasstheit mit Brauchtum und Traditionen finden sich in mehreren Arbeiten wieder und auch so lassen sich zwischen den Arbeiten Verbindungen schaffen. Auch das Thema Vermittlung entwickeln wir mit einer gemischten Arbeitsgruppe aus teilnehmenden KünstlerInnen, Produktion und Leitung zusammen
Du hast in einer Mail davon gesprochen, dass wir von den Künstler:innen immer Grenzgänge erwarten, selbst als Veranstalter:innen und Kurator:innen diese oft nicht wagen. Was denkst du, warum dem so ist?
Weil wir gefangen sind zwischen Stakeholdern und Shareholdern und oft den Blick verlieren, für das was wesentlich sein sollte. Wir finden zwar die Rahmen und die Bühnen, wir vermitteln, wir verkaufen, wir erklären… Aber gerade PrivatveranstalterInnen müssen oft hohe finanzielle Risiken eingehen und dann ist man schnell dabei, das Bewährte immer wieder zu wiederholen anstatt Neues zu erdenken und sich im freien Fall zu üben oder mit der Zeit zu gehen. Auch darf man nicht die Macht der Medien, der Feuilletons, der Kollegenmeinung unterschätzen! Es ist nicht leicht, sich davon freizumachen und sich einfach nur in den Dienst der KünstlerInnen und BesucherInnen zu stellen und das Beste für sie herauszuholen.
Und wie kann man das ändern?
Wir müssen weg von dieser Wettbewerbs- und Wachstumslogik in der Kunst! Es kann doch nicht sein, dass wir uns denselben Kriterien unterwerfen wie die der zügellosen Marktwirtschaft, die zum einen unsere Natur und zum anderen die Solidarität innerhalb unserer Gesellschaft auffrisst! Wir müssen weg vom Premiereneifer, Konkurrenzdenken und der Quantifizierung unserer Festivals, Ausstellungen etc. und hin zu langsameren, nachhaltigeren künstlerischen Strategien und kulturpolitischen Agenden.
Ich weiß, dass ist leicht gesagt, aber zumindest dort, wo öffentliche Fördergelder im Spiel sind MÜSSEN wir laufend das bestehende überprüfen, hinterfragen und neue Wege der Zusammenarbeit finden. Nochmal Christopher Dell: Wir müssen uns „neu verschalten“.

Stroh im Flachgau (Photo Alex Römer)
Du hast in Salzburg gute Erfahrungen mit bis zu einem gewissen Grad vorbereiteten in der konkreten Ausgestaltung aber doch sehr spontanen Auftritten gemacht. Mich würde interessieren, was deine Hoffnungen und auch Ängste davor waren und wie sich diese im Prozess des Austausch mit den Künstler:innen und auch den Menschen an den Auftrittsorten dargestellt haben.
Ich hoffe mehr Menschen damit zu erreichen. Die Menschen teilhaben zu lassen am spontanen künstlerischen Prozess (oft sind sich die KünstlerInnen im Moment des Auftritts erstmalig begegnet und haben dann improvisiert). Dass die KünstlerInnen diese Freiräume als Chance nutzen, sich anders zu begegnen und auch neue Bühnensituationen zu kreieren. Dass das Festival auch ohne mich funktioniert und mehr an den Bedürfnissen der KünstlerInnen ausgerichtet ist. Dass KünstlerInnen sich vermehrt trauen, die Räume zu nehmen, die die Stadt uns als Raum bietet, ohne dass ein Festival erst die Türen „aufsperren“ muss.
Was die Ängste betrifft: dass die Partner abspringen, die KünstlerInnen und BesucherInnen genervt, frustriert oder enttäuscht sind, es keiner versteht, keiner kommt – ich hatte unter anderen „Blind-Date-Konzerte“ geplant, wo ich niemanden für gebucht hatte und lediglich den KünstlerInnen auf dem Festival mitgeteilte, dass es diese Räume mit Steckdose, Mischpult und potentiellem Publikum zu diesen oder jenen Uhrzeiten gibt, den Rest habe ich losgelassen.
Das ging sich mal positiv, mal negativ aus. In einem Jahr hatte ich eine offen Impro im barocken Mirabellgarten geplant und atte die KünstlerInnen der Stadt und des Festivals informiert, dass ich Sonntag von 11 bis 14 Uhr die Genehmigung für Freispiel im Garten habe und alle eingeladen sind, diesen verwunschenen Garten als Raum zu nehmen, für was auch immer (der ist sonst super reglementiert der Park!). Ansonsten habe ich nichts geplant und das Ganze nur als Finale des Festival angekündigt mit IMPRO im Park. Ich war selber schon um 10 Uhr da, mit meinen Leuten aus dem Team und Freunden – bis 11 noch kein keine KünstlerIn, dafür aber hunderte von Menschen, die in den Park strömten in der Erwartung eines Grand Finale des fünftägigen Festivals (das fand sonst immer üblicherweise sehr gesettelt im Landestheater statt, damit wollte ich aber brechen). Ich bin circa eine Stunde lang von den verschiedensten Menschen gelöchert und beschimpft worden, was dass denn für ein Fake sei. Dabei stand im Programmbuch, dass „selbst die Intendantin nicht weiß, ob oder wer denn kommt und was wer macht“, aber das wollte keiner glauben, dass ich das wirklich nicht wusste! Naja, später kamen dann doch noch ein paar verkaterte MusikerInnen, Clowns, AkteurInnen und es wurde noch ein schöner Nachmittag – aber er blieb deutlich unter meinen Erwartungen. Schwierig war es, das im nächsten Jahr wieder durchzusetzen, aber ich wusste, dass sie jetzt begriffen haben würden. Es war dann richtig gut und keiner will jetzt mehr ins Landestheater!
Ein positives Beispiel: Dass ich so offen programmiere hat sich zwischendurch rumgesprochen und mittlerweile freuen sich die BesucherInnen genau auf diese Formate, aber auch KünstlerInnen die mich gezielt darauf ansprechen, dass sie bei diesen offenen Formaten dabei sein wollen. Außerdem sind so tolle Verbindungen entstanden zwischen MusikerInnen, die seitdem und bis heute zusammenarbeiten.
Was ist für dich SUPERGAU?
Eine echte Herausforderung, ein neuer Blick, eine neue Landschaft und ein Raum für neue Begegnungen. Ich bin wieder ganz am Anfang, muss Raum schaffen, Türen öffnen, lernen.
Es ist auch ganz persönlich für mich die Chance zu zeigen, dass ich nicht die Jazz Expertin bin und es nie war, dass Jazz nur die erste Gelegenheit war, mir eine Spielwiese zu schaffen, die auch jede andere Form von Kunst hätte sein können. Dass es bei meiner Arbeitsweise nicht um Fachwissen, sondern im Grunde genommen nur um Gastgeberschaft geht.
SUPERGAU ist als Festival für zeitgenössische Kunst ein dünnes Eis, das ich betrete, als Laie in einer ExpertInnen Welt.
Für unsere BesucherInnen und KünstlerInnen ist der SUPERGAU eine tolle Landschaft, die es zu entdecken gilt und in der nichts richtig oder falsch sein muss.
Tina, hast du einen persönlichen Lieblingsort im SUPERGAUGebiet?
Die Badestelle am Obertrumer See, wo ich noch im Herbst mit meiner lieben Kollegin Heike eingestiegen bin und ein Afghanischer Geflüchteter auf einer Bank am Ufer saß und uns aus seiner Box Lieder aus seiner Heimat vorspielte. Ich freue mich jetzt aber total darauf neue Lieblingsorte zu entdecken.













 SUPERGAU
SUPERGAU