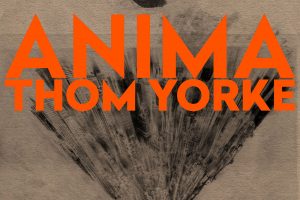MG “MG”
MG
“MG”
(Mute)
Wir alle kennen die Songs von Martin Gore. Er ist die ausschlaggebende Kraft hinter dem unverwechselbaren Sound seiner Band Depeche Mode. Dass er „die Gabe“ besitzt, sollte also unbestritten sein. Wenn ein solcher Künstler ohne seine Band arbeitet, ist es interessant zu sehen, ob sich dabei ein anderer persönlicher Kern seiner Arbeit herausschält. Bei seinen letzten Soloprojekten hat Gore diese Indiskretion geschickt vermieden, indem er einfach mit Coverversionen anderen huldigte, oder zusammen mit seinem ehemaligen Bandkollegen Vince Clarke Techno machte.
Mit “MG” legt er jetzt die Karten auf den Tisch und zeigt, was ihm am Herzen liegt: im luftleeren Raum angeordnete synthetische Klanginseln, die sich stark auf die Wurzeln rein elektronischer Musik berufen. Eine Liebeserklärung an den reinen Synthesizerklang. Das rein instrumentale Album klingt zunächst komplett anders als die unterkühlten, lakonischen Pophymnen von Depeche Mode. Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass Tracks wie „Elk“, das den Impuls für den Rest des Albums gab, eigentlich für das letzte Depeche Mode Album gedacht waren, also ursprünglich DM-Tracks sind. Und spätestens ein Stück wie „Trial“ kann man sich mit leicht erhöhtem Tempo auch gut von seiner Band gespielt vorstellen.
Davon abgesehen lebt Gores Schaffen von der unterkühlten, anorganischen Stimmung. Diese metallene Beschaffenheit der Sounds, die man auch mit Depeche Mode verbindet, kann Gore auf seinem Soloalbum noch steigern, indem er fast ausschließlich Synthesizer benutzt, die zwar nicht unbedingt Vintage sind, aber definitiv so klingen, wenn sie einsam vor sich hin brummen, dröhnen und läuten. Da passt es, dass die Titel von Stücken wie “Exalt”, “Hum” oder “Creeper” allesamt so klingen wie die Namen von Synthesizer-Presets. Gore selber hatte nach eigener Aussage den Soundtrack zu einem imaginären Science Fiction Film im Sinn, als er die sechzehn Stücke aufnahm. Die Frage ist, ob er dabei die Sorte Science Fiction meint, in der muskulöse Endzeit-Barbaren auf Motorrädern herumfahren und Schweinsgroße Ratten mit Flammenwerfern erledigen, oder eher die Sorte Science Fiction, wo sich schöne unglückliche Menschen in perfekt ausgeleuchteten antiseptischen Räumen herumdrücken und befürchten, dass etwas mit ihrem Erbgut nicht stimmt. Das Gute: möglich ist beides. Gore vereint hier reine elektronische Musik, die zuweilen an die Pioniere dieses Genres wie Morton Subotnick erinnert, mit Pop, indem er mehr oder weniger subtil Struktur und Rhythmus in die abstrakten Soundlandschaften legt und sie so zugänglicher macht.
Dieses Art von Zugeständnis läuft immer Gefahr im Kitsch zu enden, aber selbst wenn dem so ist, haben wir es hier mit einer sehr liebevollen Form davon zu tun.
Martin Riemann
Martin Gore gilt ja als der Schmusetyp von Depeche Mode. Jetzt nicht im Posterboy Sinn für die breite Masse der Fans der Band, die hängt bekanntlichermaßen seit jeher an den Lippen von Dave Gahan. Aber die Anderen, denen dessen Egozentrik und Souveränität und Sicherheit (die, wie sich dann ja zeigen sollte, gar nicht so geerdet waren, sondern einmal mehr doch nur der brüchige Spiegel des bis ins Klischeehafte ausgelebten Rockstartums) irgendwie peinlich waren, deren Augen haften bei den Konzerten auf dem verhuschten, verträumten, immer sympathisch ungesund wirkenden Martin Gore und seiner melancholischen Aura.
Wo Gahan im Scheinwerferlicht gerne seine Pioretten dreht, weiß Gore stets, wo der nächste Vorhang einen ihm gut zu Gesicht stehenden Halbschatten wirft. Und so kreiiert er zwar 90% der Songs von Depeche Mode mehr oder weniger im Alleingang, aber macht sich rar in den Ausflügen an die Pole Position der Band – und wenn er sich dann hin begibt, hat man sofort Angst, dass das alles emotional zu viel werden könnten, und die fragilen Songs ihm quasi unter der Zunge zerbröseln.
Von diesem positiven Drama waren auch die zwei bisherigen Soloalben“Counterfeit 1” und “Counterfeit 2” Zeugnis, auf denen er sehr unterschiedliches Repertoire von Künstlern wie The Durutti Column, Sparks, John Lennon, Marc Bolan, Lou Reed oder Nick Cave reinterpretierte und verblüffend leicht sich aneignete. Er fand seine eigenen Candys, die durch ihn sprachen.
Doch nun hat sich Martin Gore dazu entschieden, ein Soloalbum zu produzieren, auf dem er nicht nur auf seine gängige Art Musik zu spielen zurückgreift. Ein bisschen hat sich das mit VCMH, dem gemeinsamen Projekt mit Vince Clarke angekündigt gehabt. Es ist eine Entscheidung hin zu originären Songs ohne das Bungee-Netz der zart-zerbrechlichen Gesangslienien. Dass das Ergebnis heftigst düster ausfällt, wer hätte es nicht geahnt. Schon immer wusste man, wie abgründig und fremd sich der Sound von Depeche Mode anfühlen würde, wenn er nicht rockistisch und kitschig gebrochen würde durch die beiden Sänger und die am Gesang hängende Dramaturgie. Wenn man all das rausfiltert, findet man Songs, die, vom jeweiligen Zeitgeist abgesehen, direkt hier her zu “MG” führen.
Alle Songs auf “MG” sind übrigens mit nur einem Wort betitelt, Wörtern wie “Swanning”, “Elk”, “Europa Hymn” oder “Southerly”, womit Martin Gore sehr gut die Kompromisslosigkeit unterstreut, die das Album auszeichnet. Ein aufwühlendes Werk an der Schnittsstelle von Industrial, Noise und Techno und damit im Epizentrum der aktuellen Soundästhetik ist ihm gelungen, eines das zeugt, dass Gore auch im vierten Jahrezehnt als Songwriter noch nicht ins stolpern gekommen ist, sondern noch immer die Zeit fortschreibt.
Thomas Venker