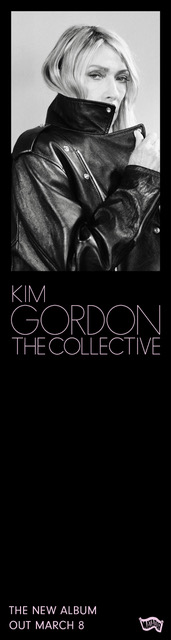Das Film Festival Cologne mit u.a. “Cold War”, “The Last Movie”, “Die Blüte des Einklangs”, “Burning”
Zwei Handvoll Klassefilme, Stars und Premieren, überschaubarer Branchentreff, ein paar Preisverleihungen, ein kleiner roter Teppich – das Film Festival Cologne bemüht sich gar nicht erst, mehr als eine niedliche Variante der berühmten Filmfestivals in aller Welt zu sein.
Warum die Festivalleitung nun ausgerechnet ein Bild aus „The House That Jack Built“, dem neuesten Gewaltporno des Unsympathen Lars von Trier das offizielle Plakat zieren lässt, wäre noch zu klären.
Unser Kaput-Cineast Dirk Böhme möchte sich diesen Film gerne ersparen und hat für die nächsten Tage im Filmpalast am Hohenzollernring stattdessen andere Höhepunkte aus dem Programm auf dem Zettel. Um genau zu sein: Etwa ein Dutzend Filme aus den Festivalreihen Best Of Cinema, Look und Made in NRW – immer aktuell hier besprochen.
Tag 7 … Finale!
Am letzten Festivaltag gönnt sich unser Erzähler noch mal ein postapokalyptisches Drama aus der Berliner Schule, bevor die Deutschlandpremiere von Luca Guadagninos „Suspiria“ abschließend für große Enttäuschung sorgt.
 IN MY ROOM
IN MY ROOM
(D 2018, Regie: Ulrich Köhler)
Armin ist Anfang 40, einsam, beruflich wenig erfolgreich. Seine geliebte Oma liegt im Sterben und wird zuhause vom Vater gepflegt. Armin fährt zu ihnen ins Heimatdorf. Als er eines Morgens aufwacht, ist die gesamte Menschheit verschwunden. Armin ist der letzte Mensch auf der Erde.
Aus einem bekannten postapokalyptischen Genre-Szenario macht der Berliner Regisseur Ulrich Köhler in seinem vierten Spielfilm ein überraschend geradliniges Survivaldrama, das einen traurigen weißen Mann erst dann aus seiner Einsamkeit entlässt, wenn alle anderen Menschen verschwunden sind.
Die graue deutsche Tristesse im Winterregen im ersten Akt wird nach der (nie erklärten) fantastischen Wendung zu einem sonnigen Naturabenteuer, in dem sich Armin jenseits aller gesellschaftlichen Fesseln aus seiner Trauer und Depression befreit. Ohne den Zwang zur sozialen Interaktion kann dieser moderne Robinson Crusoe endlich alles zurücklassen und zum Leben erwachen. Im zweiten Akt sieht Armin cool aus mit drahtigem Körper, Knarre und Pferd, er züchtet Nutztiere und entwickelt großes technisches Geschick beim Bau eines neuen Eigenheims. Eine weitere Wendung im dritten Akt
Köhler stellt die großen Sinnfragen: Wer bin ich, warum bin ich hier und was brauche ich eigentlich, um Mensch zu sein? Dass das nicht in Naturkitsch oder reaktionären Antimodernismus mündet, ist seinem No Bullshit-Ansatz zu verdanken, der sich im Zweifel lieber am klassischen Abenteuerfilm orientiert und dank des physischen Spiels des großartigen Hauptdarstellers Hans Löw auch humorvoll die Ideologie klassischer „Männlichkeit“ unterläuft. Und wie bitteschön kann man einen Film nicht lieben, der „Later Tonight“ von den Pet Shop Boys so wundervoll zum Einsatz bringt?
Mit „In My Room“ eröffnet, nach Valeska Grisebachs „Western“ und Christian Petzolds „Transit“, die Berliner Schule weiter sehr erfolgreich ihren Spielraum in Richtung universelles Erzählkino. Nun wäre also Köhlers Partnerin Maren Ade wieder am Zug, aber die lässt sich ja leider immer sehr viel Zeit für ihre Filme.
 SUSPIRIA
SUSPIRIA
(I/D, 2018, Regie: Luca Guadagnino)
Dario Argentos „Suspiria“ (1977) ist ein Klassiker des Horrorfilms, eine in das schönste Blutrot getauchte, expressionistische Rock-Oper voller Hexenbrimborium, Gewaltexzesse und Hysterie. Die Geschichte? Egal.
Für sein Remake hat sich der Stilist Luca Guadagnino nun entschieden, die Farben des Originals komplett zu entsättigen, den Schauplatz ins Berlin des Deutschen Herbstes 1977 zu verlegen und die Geschichte um Anspielungen auf Weltkrieg und Holocaust zu erweitern.
Das matte Braungrau, die Dunkelheit, die miefige Stuben-Atmo der 70er Jahre-BRD liegt über „Suspiria“ (2018), und mit Nebendarstellerinnen wie Ingrid Caven oder Angela Winkler unterstreicht Guadagnino auch den Einfluss des deutschen Autorenkinos auf seinen Film. Während Kameramann Sayombhu Mukdeeprom in Guadagninos Meisterwerk „Call Me By Your Name“ das Bild in langen Einstellungen und langsamen Kamerafahrten an seine Charaktere heranführte, herrscht nun mit Zooms und schnellen Schwenks auf Tilda Swintons starres Gesicht von Beginn an Unwohlsein.
Stilitisch hat Guadagnino also einen Plan, jedes Detail stimmt, jeder Schnitt sitzt.
Aber die Story? Sie ist, weil der Regisseur eben bewusst die barocke Opulenz des Originals vermissen lässt, hier nicht egal, und daher stellen sich schnell Fragen. Warum steht im Mittelpunkt des Films eigentlich ein sich irgendwie seltsam bewegender und sprechender alter Professor, der seiner verlorenen Liebe aus dem Krieg nachtrauert? Warum bekommen wir ständig Fernsehnachrichten von RAF, Mogadischu und Stammheim präsentiert? Was hat das alles mit dem freakigen Hexensabbat in der Tanzschule zu tun?
Hexengrusel als feministisches Coming of Age ist ein bewährtes Erzählkonzept, das zuletzt Robert Eggers in seinem Folkhorror „The Witch“ erfolgreich verarbeitete.
Guadagnino war das aber wohl nicht genug. Über Genrekonventionen hinaus wollte er auch einen politischen Film drehen. Doch zwischen dem ganzen schrillen Hokuspokus und der trashigen Gewalt noch einen Zusammenhang zum Deutschen Herbst oder gar der Shoah herstellen zu wollen, war eine fragwürdige dramaturgische Entscheidung, vielleicht sogar Ausdruck einer erzählerischen Hybris.
Weil Guadagnino seinen Film derart überfrachtet mit nie begründetem Subtext oder Nebensträngen, gelingt es ihm auch nicht, Angst zu erzeugen – für einen Horrorfilm ist das leider etwas ungünstig.
Auch Thom Yorkes traurige Songs wirken fehl am Platz in einem Film, der daran scheitert, uns Zuschauer in seine Welt hineinzuziehen oder für seine Figuren zu interessieren. Damit ist „Suspiria“ wirklich das genaue Gegenteil von „Call Me By Your Name“ und Guadagnino mit seinem Herzensprojekt ziemlich krachend gescheitert.
Und so endet die Festivalwoche leider mit einer großen Enttäuschung.
Und hier noch die 14 Filme in 7 Tagen als knackiger Soundbite:
Hervorragend:
BURNING (Chang-dong Lee)
LAS HEREDERAS (Marcelo Martinessi)
Sehr gut:
A LAND IMAGINED (Siew Yua Heo)
IN MY ROOM (Ulrich Köhler)
ASCHE IST REINES WEISS (Jia Zhang-ke)
Gut:
COLD WAR (Pawel Pawlikowski)
HIGH LIFE (Claire Denis)
MADELINE’S MADELINE (Josephine Dekker)
Enttäuschend:
SUSPIRIA (Luca Guadagnino)
Problematisch:
WINTERMÄRCHEN (Jan Bonny)
Mies:
VISION (Naomi Kawase)
THUNDER ROAD (Jim Cummings)
THE LAST MOVIE (Dennis Hopper)
LORO (Paolo Sorrentino)
——–
Hier noch mal alles zum Nachlesen:
 Cold War
Cold War
(PL 2018, Regie: Paweł Pawlikowski)
Eröffnet wurde das Festival am Freitagabend vom international bereits sehr gefeierten „Cold War“, für den der polnische Regisseur Paweł Pawlikowski in Cannes den Regiepreis gewonnen hat.
„Cold War“ bündelt in einer sensationell kurzen Laufzeit von 85 Minuten Elemente aus dem Musikfilm, historischen Drama und einer epischer Liebesgeschichte und ist dabei eine minimalistische Arthaus-Variante der ganz großen Liebesdramen Hollywoods vor historischer Kulisse (“Vom Winde verweht”, “Casablanca”, “Doktor Schiwago”): wir begleiten ein Liebespaar über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten im politischen Chaos zwischen Ost und West nach dem zweiten Weltkrieg.
1949 in einer sozialistischen Musikschule in Polen; der Musiker Wiktor und die Sängerin Zula verlieben sich ineinander. Doch der stalinistische Apparat macht eine Musikkarriere ebenso unmöglich wie eine Beziehung. Vier Jahre später scheitert die gemeinsame Flucht nach Paris. Immer wieder begegnen sie sich im Lauf der Jahre kurz. Als sie endlich im Ausland zusammenkommen, möchte sich die erhoffte Harmonie aber nicht einstellen.
Pawlikowskis visuelle Ästhetik ist von großer formaler Strenge: Wie schon in „Ida“ setzt er auf die glasklare Schwarzweißfotografie des Kameramanns Łukasz Żal und das klassische 4:3 Bildformat – bildtechnisch sieht „Cold War“ aus, als sei er Ende der 50er Jahre entstanden. Pawlikowski verzichtet außerdem auf Filmmusik und lässt in seiner Erzählung bewusst große Lücken, die wir Zuschauer*innen selbst füllen müssen. Die großen Gefühle möchte er uns nicht zeigen, wir müssen uns entlang kurzer Episoden in Wiktor und Zula hineinversetzen.
Die Verweigerung dramatischer Höhepunkte, die großen Zeitsprünge in der Handlung und die bruchstückhafte Erzählstruktur haben mir allerdings etwas zu schaffen gemacht: trotz der guten Chemie zwischen den beiden wunderbaren Hauptdarstellern Joanna Kulig und Tomasz Kot ist Pawlikowskis verfremdende Distanz dann doch ein bisschen zu spröde, und anders als im todtraurigen Meisterwerk „Ida“ hat mich Pawlikowskis kahler, kalter Stil hier leider von den Figuren und ihren Gefühlen eher ferngehalten.
Tag 2
Am zweiten Festivaltag sieht Kaput-Reporter Dirk Böhme zwei großartige Filme aus Film-Entwicklungsländern (Singapur, Paraguay) und gähnt sich zum Abschluss durch restaurierten New Hollywood-Nihilismus.
 A Land Imagined
A Land Imagined
(SIN, 2018, Regie: Siew Yua Heo)
Singapur wächst und wächst. In 50 Jahren hat der Stadtstaat seine Fläche um ein Fünftel vergrößert. Dafür werden Sand und Stein aus Nachbarländern angekarrt und im Meer aufgeschüttet. An den Stränden ist daher ein ungeheures Arsenal an Baugerät versammelt, das von modernen Lohnsklaven bedient wird, meist Wanderarbeitern aus China oder Bangladesch. Die erhalten zunächst eine Vorabzahlung und müssen dann ihre Schulden abarbeiten, ihre Pässe werden weggesperrt.
Das Verschwinden zweier dieser Arbeiter ist der Ausgangspunkt des zweiten Spielfilms des singapureanischen Autorenfilmers Yeo Siew Hua. Yeo lässt einen an Schlaflosigkeit leidenden Inspektor in diesem Fall ermitteln und wagt dabei einen originellen Genremix aus Film Noir, sozialem Realismus und Mystery Thriller.
Yeo zeigt den verschwitzten, schmutzigen Alltag, vom Hochglanz der Finanzmetropole ist nichts zu sehen. Der Thrillerplot entwickelt sich schnell zu einem flirrenden (Alp)traum in Neonlicht, die Übergänge von Realismus zu Magie sind fließend. Inspektor Loks schlafwandlerische Ermittlungen führen ihn in ein Cybercafé, in dem sich der verschwundene Arbeiter Wang wie zahllose andere junge Leute beim Egoshooter oder Porno die Nacht um die Ohren geschlagen und dort per Chat von einem Avatar kontaktiert wurde.
Ein schwer zu greifender Film, der sich im Verlauf der klassischen Krimihandlung immer wieder einer logischen Narration verweigert und damit gleichermaßen an David Lynch erinnert wie an die Traumfilme des thailändischen Regisseurs Apichatpong Weerasethakul. Hier hat Yeo eine faszinierende Form gefunden für seinen empathischen Blick auf die Gesichter hinter der globalen Ausbeutung und die Kritik am kapitalistischen Raubbau.
 Las Herederas
Las Herederas
(PAR, 2018, Regie: Marcelo Martinessi)
Chela und Chiquita leben seit Jahrzehnten als Paar in Asunción, im erzkatholischen Paraguay ist offen gelebte Homosexualität allerdings tabu, daher gelten sie offiziell als „Schwestern“. Das gemeinsame Leben in Chelas Geburtshaus ist recht freudlos: Chela wirkt depressiv, Chiquita kümmert sich um ihre Pflege und den Alltag. Da sie hoch verschuldet sind, müssen sie nach und nach das Mobiliar verkaufen. Als Chiquita wegen einer Betrugsklage sogar ins Gefängnis muss und sich dort aufgrund ihres dominanten Charakters schnell arrangiert, erwacht Chela zuhause aus ihrer Trägheit und findet langsam zurück ins Leben, indem sie ältere Damen durch die Stadt chauffiert.
Ein stiller, berührender Film über die Selbstermächtigung einer älteren Frau und Machtdynamiken in einer Beziehung, der uns nebenbei auch von den Barrieren innerhalb der Gesellschaft Paraguays und vom Verfall der ehemaligen Oberschicht erzählt. In seinem ersten Spielfilm setzt der paraguayanische Autor/Regisseur Marcelo Martinessi ausschließlich auf Frauen und hat für die verschiedenen komplexen Charaktere großartige, bis dahin völlig unbekannte Darstellerinnen gefunden.
Die zentrale Kraft des Films ist Ana Brun. Sie spielt Chelas Befreiung aus der Passivität in einer abgenutzten Beziehung mit subtiler Mimik. Chelas unterdrückte Gefühle brechen sich allmählich Bahn und finden Ausdruck auch in einer Verwandlung des äußerlichen Erscheinungsbilds (coole Brille, Jeans, Make Up). Bei der Berlinale gewann Ana Brun dafür den Preis für die beste Schauspielerin.
Heimlicher Star ist María Martins, die als giftige Seniorin Pituca einige herrliche Einzeiler liefert und damit in einem insgesamt eher wehmütigen Film sogar für Lacher sorgt.
Mit Marcelo Martinessi hat die Filmwelt ein großes Talent gewonnen: Sein vielschichtiges Drehbuch und die elegante Regie erzählen uns eine universelle Geschichte aus dem Blickwinkel einer sehr speziellen Situation in einem abgelegenen Ort in der Welt. Vielleicht sorgt ja der erfreuliche Erfolg des Films dafür, dass wir bald mehr Filme aus Paraguay zu sehen bekommen, oder noch besser: mehr Filme über die ältere LGBT-Generation.
 The Last Movie
The Last Movie
(USA, 1971, Regie: Dennis Hopper)
Lange in den Archiven verschüttet, jetzt digital restauriert: Dennis Hoppers „The Last Movie“ ist ein strahlender Beweis dafür, dass manche Filme auch ZU RECHT in Vergessenheit geraten sind und nicht jeder kommerzielle Flop des New Hollywood 40 Jahre später automatisch KULT werden sollte.
1970 bekam Hopper für den Nachfolgefilm zu seinem Welterfolg „Easy Rider“ von den euphorisierten Universal Studios eine Million Dollar und völlig freie Hand für die Produktion eines lange geplanten Projekts mit Stewart Stern, dem Autor von „Rebel Without A Cause“. Mit einer großen Crew und Freunden reiste Hopper nach Peru und drehte dort einen Meta-Western als Abgesang auf das alte Hollywood, aber in seiner nihilistischen Weltsicht auch geprägt vom Abschied von den Idealen der Hippie-Kultur (und darin auch vergleichbar mit „Easy Rider“).
Problem dabei war Hoppers exzessiver Drogen- und Alkoholkonsum. Da er sich selbst auch in der Hauptrolle besetzte (als Stuntman Kansas), kann man sich von seinen geweiteten Pupillen und dem manischen Blick auf der Leinwand sehr gut selbst überzeugen.
Dass Hopper in diesem Zustand auch später im Schneideraum nicht klarkam (und sich von seinem Freund Alejandro Jodorowsky den Psychedelia-Floh ins Ohr setzen ließ), kann daher nicht überraschen. Das Ergebnis ist dementsprechend ein wirres Machwerk, das Dreharbeiten zu einem Western (Gastrolle für den alten Independentkino-Haudegen Sam Fuller), peruanische Folklore, endlose Idiotengespräche und fürchterliche Frauenfeindlichkeit zu einem inkohärenten Blödsinn zusammenschnipselt.
Es gibt keine einzige sympathische Figur in diesem Film, stattdessen bekommen wir narzisstische Nabelschau, Gewalt an Frauen, eine grauenhafte Sexorgie und einen sehr komischen Blick auf die indigene Bevölkerung. Was auch immer Hopper hier erzählen wollte (Gegenkultur versus Hollywood? Parabel auf Vietnam? USA am Ende?), es funktioniert selbst als finsterer Abgesang überhaupt nicht. Die schönen Songs (unter anderem Kris Kristoffersons „Me And Bobby McGee“) wirken wie Fremdkörper. Ich habe mich selten im Kino so gelangweilt.
Wer sich dennoch für Dennis Hoppers Karriere als Außenseiter-Regisseur interessiert, sei daher vor allem an sein wenig gesehenes Punk-Meisterwerk „Out Of The Blue“ (von 1980) erinnert, oder im Zweifel natürlich einfach noch mal „Easy Rider“ gucken.
Tag 3
Heute bot das Festivalprogramm gleich zwei Filme von Regisseurinnen an, in denen Juliette Binoche einen Orgasmus hat.
.
 DIE BLÜTE DES EINKLANGS
DIE BLÜTE DES EINKLANGS
(VISION, JAP 2018, Regie: Naomi Kawase)
Die japanische Regisseurin Naomi Kawase ist seit vielen Jahren eine feste Größe im internationalen Festivalzirkus mit Filmen, die um die Themen Naturverbundenheit, Heilungsprozesse und Familie kreisen. Das sind auch die Eckpunkte von „Vision“, für dessen deutschen Titel „Die Blüte des Einklangs“ sich der deutsche Verleih großzügig in der Esoterik-Ecke des Bahnhofsbuchhandels bedient hat.
Und das gar nicht mal zu Unrecht! Denn die Reise gegen den seelischen Schmerz der Vergangenheit, den die Biologin Jeanne (Juliette Binoche) auf der Suche nach einem mythischen Heilkraut namens „Vision“ in Japans saftig-grüne Wälder unternimmt und dort einem traurigen Waldhüter (Masatoshi Nagase) begegnet, ist einerseits der leiseste Film des Jahres, vor allem aber purer New Age-Kitsch fürs Arthaus-Publikum.
Ständig richten die Darsteller ihren Blick wehmütig gen wehende Baumwipfel. Hauchzart und zerbrechlich huschen sie durch wunderschön fotografierte Wälder und Stuben. Der Sex ist superschön. Das wäre gerade noch zu ertragen, wäre da nicht die Pennälerpoesie der Dialoge. „Tod ist Teil eines langen Schlafs“, darf Binoche mal sagen, oder sogar: „Liebe ist wie die Wellen – sie endet nie.“
Das ist Terrence Malick nach einer japanischen Entschlackungskur, oder besser: für noch Ärmere. Es ist eben ein schmaler Grat (sic) zwischen Haiku und HURZ.
„Welche Schönheit“ sind die letzten Worte, natürlich gehaucht zu traumhafter Naturfotografie. Ein Film, der in Schönheit stirbt.
Trailer hier…
 HIGH LIFE
HIGH LIFE
(F/USA/GB/D 2018, Regie: Claire Denis)
Claire Denis hat nun also offiziell den trostlosesten Science Fiction-Film aller Zeiten gedreht, einen düsteren Brocken aus Schmutz, Stille und Sperma, neben dem sogar „Alien“ wirkt wie die Muppet Show. Während der Deutschland-Premiere im großen Saal des Filmpalasts konnte man jedenfalls eine Stecknadel fallen hören. Vor allem der anwesende Robert Pattinson-Fanclub in der ersten Reihe hatte vermutlich was Anderes erwartet.
Eine Gruppe Schwerverbrecher wird in einem kleinen Raumschiff zusammengesperrt und in Richtung eines Schwarzen Lochs geschickt, um der Menschheit eine mögliche rettende Energiequelle zu erschließen. Dieses Höllenfahrtskommando bereichert eine irre Wissenschaftlerin / Fruchtbarkeitsgöttin (Juliette Binoche), die der Besatzung Psychopharmaka verabreicht, ab und zu eine Masturbationsmaschine besteigt und ansonsten den restlichen Insassen Körperflüssigkeiten abnimmt. Ihr Ziel: das erste im Weltall gezeugte und geborene Baby. Nach und nach reduziert sich die Zahl der Besatzung auf gewaltsame Weise.
Die Weltsicht der inzwischen 71jährigen Claire Denis, die mit „Beau Travail“, „Trouble Every Day“ oder „White Material“ einige Höhepunkte des europäischen Schlechte Laune-Kinos geschaffen hat, muss entsetzlich düster sein. Das Zusteuern auf ein schwarzes Loch, und während der Fahrt macht man’s sich nicht etwa ein bisschen schön, sondern lässt alles verkommen und den Bach runtergehen? Das ist ja eine nur wenig subtile Metapher auf unsere Zeit. Und die Menschen? Denen gönnt Denis keine Sekunde Freude. Die Interaktionen sind abweisend oder verachtend; Sex dient nur der Reproduktion oder der Gewalt, lustvolles Zusammensein gibt es nur mit einer Maschine (der „fuck box“) aus dem Body Horror-Arsenal eines David Cronenberg.
Ein zwar fesselnder, aber auch extrem unangenehmer und harter Film, dessen Hoffnungslosigkeit wirklich zu schaffen macht. Ich wurde außerdem das Gefühl nicht los, dass Juliette Binoche die einzige Schauspielerin war, die wirklich wusste, welche Rolle sie da spielt. Selbst Robert Pattinson (der schon im letzten Jahr mit dem grandiosen „Good Time“ in Köln vertreten war) wirkt etwas distanziert und ratlos. Theorie: Claire Denis wollte die Depression und Sedierung ihrer Figuren sicherstellen und daher auf jeden Fall vermeiden, dass ihre Darsteller zu viel spielen.
Für alle, die sich ebenfalls den Tag verderben möchten: „High Life“ kommt im Januar offiziell in die deutschen Kinos.
Tag 4
Ein Festivaltag mit entschleunigter Spannung aus Südkorea und zwei nervenzerrenden amerikanischen Indieproduktionen. Dem Kaput-Cineasten Dirk Böhme wurde heute einiges abverlangt.
 BURNING
BURNING
(KOR 2018, Regie: Chang-dong Lee)
Um eine Kurzgeschichte („Barn Burning“ von Haruki Murakami) auf zweieinhalb Stunden Spielfilm zu dehnen, bedarf es viel Selbstbewusstsein und Können. Dem südkoreanischen Festivalliebling Lee Chang-dong mangelt es an beidem nicht. Auf die extreme Entschleunigung seines Erzähltempos muss man sich einlassen – wird aber nachhaltig belohnt.
Der junge Slacker Jong-su lebt im Landhaus seines verhassten Vaters, der gerade eine Gefängnisstrafe angetreten hat. Zur Mutter hat er ohnehin keinen Kontakt mehr. Er möchte Schriftsteller werden, hat aber noch nichts zu Papier gebracht. Als Jong-su seiner ehemaligen Schulkameradin Hae-mi begegnet, verfällt er ihr hoffnungslos. Sie reist kurz darauf nach Afrika und bittet ihn, ihre Katze zu versorgen. Hae-mis Rückkehr findet leider in Begleitung des reichen Schnösels Ben statt, und ab sofort ist der lethargische Jong-su nur noch ein Anhängsel in dieser Dreierbeziehung. Dann verschwindet Hae-mi spurlos.
Ein um rätselhafte Elemente angereicherter Neo-Noir, der viel über das Leben junger Leute und das Klassensystem im modernen Südkorea, vor allem aber über Einsamkeit der Hauptfiguren erzählt. Sowohl die mittellosen Jong-su und Hae-mi als auch der wohlhabende Ben sind inmitten des Trubels der Großstadt in ihren jeweiligen Geschichten isoliert. Ihre Wege kreuzen sich flüchtig, aber sie gehen jeweils völlig unterschiedlich mit der Einsamkeit um.
Seine Spannung bezieht „Burning“ aus dem geduldigen Spiel mit der Erwartungshaltung des Publikums und nur spärlich gestreuten Indizien. Dass wir hier möglicherweise einen Thriller sehen, dämmert uns erst nach über 90 Minuten. Der Film lässt offen, ob wir einem tatsächlichen Kriminalfall folgen oder nur der lebhaften Fantasie eines antriebslosen Möchtegernschriftstellers und steuert dabei auf ein dramatisches Finale zu.
Und auch wenn man zwischendurch mal etwas durchgehangen haben mag, lässt einen die Auflösung hinterher nicht mehr so schnell los.
„Burning“ ist ein Höhepunkt des Filmjahres. Dass er trotzdem keinen Kinostart in Deutschland bekommen soll, ist völlig indiskutabel. Hallo deutsche Kinoverleiher, was ist da los?
Trailer
 THUNDER ROAD
THUNDER ROAD
(USA 2018, Regie: Jim Cummings)
Der weiße amerikanische Mann: das jämmerliche Wesen. Noch mehr lächerlich machen als in „Thunder Road“ kann man diese ja bitteschön auf keinen Fall bemitleidenswerte Spezies wirklich nicht mehr.
Für sein Erstlingswerk lässt Regisseur Jim Cummings die Kamera immer wieder langsam auf das grimassierende Gesicht von Hauptdarsteller Jim Cummings zoomen. Um das zu rechtfertigen, erzählt Drehbuchautor Jim Cummings eine Tragikomödie vom psychisch labilen Polizisten Jim (!), der durch den Tod seiner Mutter und den Sorgerechtsstreit um die einzige Tochter endgültig aus der Fassung gerät.
Dass sich um ein gesellschaftlich akutes Thema handelt, beweisen die begeisterten Stimmen in den USA. Offensichtlich berührt die Verzweiflung der Hauptfigur bei vielen Zuschauer*innen einen wunden Punkt.
Mir allerdings ging Cummings’ Nabelschau schrecklich auf die Nerven. Gibt es so was wie narzisstischen Masochismus? „Thunder Road“ wäre zumindest ein passendes Untersuchungsobjekt. Eine schier endlose, in einer einzigen Einstellung gedrehte Eröffnungssequenz zeigt Jims Nervenzusammenbruch in einer Kirche. Wir sollen lachen, weinen und uns fremdschämen mit Jim.
Wie viel „Ugly Crying“ (gibt’s wirklich, bitte im Urban Dictionary nachschlagen) verträgt ein Film, und ist das wirklich witzig?
Mag sein, dass toxische Männlichkeit hier ein für allemal dem Publikum zum Fraß vorgeworfen werden sollte, aber die clowneske Darstellung von Trauer, Traumata und psychischer Erkrankung kann man auch ärgerlich finden. Selbstmitleidige Männer, die anstatt sich Hilfe zu holen, lieber etwas mit „Kunst“ machen, gibt es in der Film- und vor allem Musikgeschichte schon mehr als genug. Und jetzt soll ich mich auch noch für ein extremes Zerrbild dieses Phänomens interessieren? HELL NO!
(Dank an Denise Oemcke für die fundierte Gegenmeinung)
Trailer
 MADELINE’S MADELINE
MADELINE’S MADELINE
(USA 2018, Regie: Josephine Decker)
Ob die 16jährige Madeline wirklich an einer psychischen Krankheit leidet, oder ob ihre alleinerziehende Mutter lediglich mit der Erziehung einer „schwierigen“ Tochter überfordert ist, lässt Josephine Dekkers neuer Film offen. Überhaupt bleibt ihre Inszenierung stets bewusst vage: zwar hält Ashley Connors Kamera fast durchgehend sehr nahe auf die Gesichter, aber oft verrutscht der Fokus, das Bild wird unscharf oder verwackelt. Dekker zwingt uns, in die Psyche der Hauptfigur einzudringen.
Das experimentelle Tanztheater der Schauspiellehrerin Evangeline (Molly Parker) ist für Madeline zugleich Flucht vor dem häuslichen Druck als auch Ort einer spielerischen Suche nach Orientierung. Die junge Frau ist nun hin- und hergerissen zwischen selbstbestimmter Entwicklung und den Ansprüchen sowohl ihrer dominanten Lehrerin als auch der stets überspannten Mutter (Miranda July).
Die Debütantin Helena Howard ist ein unberechenbares Powerhouse von einer Darstellerin und eine ähnliche Entdeckung wie Royalty Hightower in Anna-Rose Holmers artverwandtem „The Fits“ oder Sasha Lane in Andrea Arnolds „American Honey“.
Howards mal liebevolle, mal grenzüberschreitende Interaktionen mit den erfahrenen Schauspielerinnen Molly Parker und Miranda July sind die stärksten Szenen in einem durch die intime Nähe der Kamera und das expressive Sounddesign durchweg fordernden Film.
Die New Yorker Autorenfilmerin Josephine Dekker, die auch als Performance-Künstlerin arbeitet, hat einen anstrengenden, aber faszinierenden Film gedreht, der vielleicht doch etwas zu wild taumelt zwischen Coming-of-age-Drama, Kunstfilm und abfotografierter Theaterprobe. Und wirklich Bock auf Improv-Theater hat mir „Madeline’s Madeline“ auf jeden Fall nicht gemacht.
Trailer
Tag 5

WINTERMÄRCHEN
(D 2018, Regie: Jan Bonny)
Den unangenehmsten Film des Festivals hat also nicht Lars von Trier gedreht, sondern Jan Bonny mit einer NSU-Sex-Farce. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Tommi und Becky leben im Untergrund. Sie wollen Ausländer töten. Das klappt erstmal nicht, unter der „Ladehemmung“ leidet auch die Beziehung der beiden. Die Stimmung ist katastrophal. Als der virile Maik in ihre Siff-WG zieht und kurz darauf die ersten Mordpläne erfolgreich umgesetzt werden, wird das Leben wilder und es läuft bald auch in der Kiste besser.
Regisseur und Co-Autor Jan Bonny hat den NSU-Prozess beobachtet und sich entschlossen, das Thema künstlerisch aus einer radikalen Perspektive zu verarbeiten. Ihm ist das Verdienst anzurechnen, sich bewusst vom üblichen didaktischen Fernsehfilmansatz fernzuhalten, unter dessen mieser Beleuchtung und biederer Ästhetik so viele deutsche Filme leiden. Dass er seine drei Hauptfiguren romantisieren würde, kann man ihm sicher nicht vorwerfen. Das Bild ist dunkel, alles ist hässlich, es wird ständig geschrien, geheult, gefickt. Sein karger, lauter Stil möchte das Publikum abstoßen und es damit zwingen, das Phänomen „rechte Gewalt“ aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und dafür neue Sprache und Lösungen zu finden, es zu entmythisieren und aus dem Glamour einer boulevardesken Faszination zu befreien. Das ist allerdings nun auch wieder nichts Anderes als Didaktik.
Auch wenn Bonny das Trio nicht vollkommen isoliert, sondern als Teil eines Netzwerks zeigt (Gastauftritt für Lars Eidinger), ist sein Blick auf den NSU bewusst kurzsichtig und intim. Die Leerstellen sind verstörend: Die drei Mörder sind nicht als Nazis erkennbar, sie folgen keiner Idee jenseits von Sucht nach Aufmerksamkeit für ihre rassistischen Taten. Abgesehen von ein paar ekelhaften Witzchen bekommen wir keinerlei Hinweise auf die ideologische Motivation oder Struktur des Terrors, keine Hakenkreuze, keinen Verfassungsschutz.
Bonny inszeniert den Naziterror stattdessen als hysterische Orgie aus Sex und Gewalt, als narzisstische Triebabfuhr. Sex und Mord sind für die Ménage-à-trois libidinöse Akte der Befreiung. Das Töten dient der Luststeigerung, das Ficken dem Antrieb zur nächsten Gewalttat. Die Opfer bleiben gesichtslos.
Dieser intensive Ansatz ist furchtbar anstrengend und schockierend anzusehen, vor allem aber ist er leider sehr problematisch. Indem rechtsextreme Gewalt ausschließlich sexuell konnotiert und auf strukturelle, soziale oder politische Zusammenhänge völlig verzichtet wird, mag radikale Kunst entstehen – der akuten gesellschaftlichen Krise, in der wir uns befinden, wird er in keiner Weise gerecht. Der Film will uns dazu bringen, neue Antworten zu finden auf die Bedrohung, blendet aber dabei die eigentlich wichtigen Fragen aus und ist in seinem Erklärungsansatz daher nicht nur banal, sondern sogar auf seine Art gefährlich.
„Freien Eintritt für AfD-Mitglieder“ kündigte die Produzentin für den Kinostart im März an – und das scheint mir, wie auch der ganze Film, Ausdruck eines fatalen Missverständnisses zu sein. Ich habe nach diesem quälenden, ärgerlichen Kinoerlebnis das dringende Bedürfnis, Hannah Arendts „Eichmann in Jerusalem – Ein Bericht von der Banalität des Bösen“ wiederzulesen.
Tag 6
Zwei Filme von Regisseuren desselben Jahrgangs wie Kaput-Cineast Dirk Böhme – was für ein Zufall! Paolo Sorrentino enttäuscht leider mit einer völlig belanglosen Berlusconi-Farce, während Jia Zhang-ke wieder beeindruckend von starken Menschen im modernen China erzählt.
 LORO
LORO
(ITA 2018, Regie: Paolo Sorrentino)
Wer braucht im Jahr 2018 noch einen Film über Silvio Berlusconi? Immerhin kann sich das internationale Publikum schon glücklich schätzen, dass Italiens Hochglanzregisseur Paolo Sorrentino die ursprünglich zwei Spielfilme immerhin auf nur zweieinhalb Stunden zusammengeschnitten hat und uns damit immerhin schon mal eine Stunde Lebenszeit geschenkt hat. Das Ergebnis ist dennoch überlanger style over substance, inkohärent und öde.
Nach einer chaotischen, an Scorseses Mafiafilme erinnernden Eröffnung, in der ein koksender Schönling schöne Frauen und Parties benutzt, um an IHN (=Berlusconi) heranzukommen, wechselt Sorrentino die Perspektive. Ab sofort begleiten wir den Dottore (=Berlusconi) beim Intrigieren, der Ehekrise und natürlich Bunga Bunga. Unzählige Frauen machen sich nackt und tanzen aufreizend, um dem mächtigen alten Mann zu gefallen.
Mit „La Grande Bellezza“, „Youth“ oder der Fernsehserie „The Young Pope“ bemüht sich Paolo Sorrentino seit Jahren um das Erbe von Federico Fellini: üppiges Kino, das in traumhaft schönen Bildern italienische Melancholie und Weirdness transportieren möchte.
Mit „Loro“ ist Sorrentino nun aber endgültig in eine Sackgasse geraten. Sein Problem ist vor allem, dass er uns NICHTS über Berlusconi erzählt, was wir nicht schon aus Nachrichten oder Klatschpresse wussten. Überhaupt wirkt der ganze Film schrecklich out of date, alles kommt zehn Jahre zu spät: die Satire, der Style, die Musik (Kyle Minogue, LCD Soundsystem).
„Loro“ hat trotz der expressiven Darstellung von Toni Servillo (der für Sorrentino in „Il Divo“ mit Bettino Craxi schon einmal einen italienischen Ministerpräsidenten spielen durfte) nichts über Silvio Berlusconi zu sagen, was wir nicht schon aus den Nachrichten wussten. Trägt der Film zu Beginn noch immerhin Züge einer Farce oder Gesellschaftssatire, entwickelt er im Verlauf zunehmend Sympathie für seinen widerlichen Protagonisten. Sorrentinos Blick auf nackte Frauen scheint ähnlich geil wie der des schwer gelifteten Milliardärs.
Der erzählerische Mehrwert ist gleich null, die Werbespotästhetik ermüdet auf Dauer, und es wird außerdem viel zu viel geredet. Und am Ende wechselt der Film sogar noch einmal komplett den Ton und zeigt pathetisch das vom Erdbeben verschüttete Aquila. Die letzten Szenen sind totenstill. Der Zusammenhang zur vorherigen Handlung? Ja, was weiß ich denn.
Völlig rätselhaft, warum ein solcher Langweiler, der weder politisch zeitgemäß noch ästhetisch von Belang ist, in einem Festivalprogramm gezeigt wird. Und nicht auszudenken, wie viele spannendere Filme man mit diesem Budget hätte realisieren können.

ASCHE IST REINES WEISS
(CHN 2018, Regie: Jia Zhang-ke)
Traurige Menschen laufen durch Architektur – kennt man von Antonioni:
Der chinesische Autorenfilmer Jia Zhang-ke erzählt seit inzwischen 20 Jahren von der rasanten Veränderung des modernen China und dem Kampf einfacher Menschen ums Überleben – oft buchstäblich.
2013 verarbeitete er etwa im fantastischen „A Touch of Sin“ die Selbstmorde von Arbeiter*innen in der iPhone-Produktionsstätte Foxconn City, und schon 2006 war die sterbende Stadt Fengjie, die dem riesigen Drei-Schluchten-Staudamm weichen musste, Schauplatz seines Meisterwerks „Still Life“.
Diese Elemente finden sich auch wieder in „Ash Is Purest White“. Im Zentrum steht die resolute Ciao (beeindruckend: Jias Stammschauspielerin Zhao Tao), die wir als Freundin des Triadenbosses Bin (Liao Fan) kennenlernen und über 16 Jahre und mehrere Schauplätze begleiten. Was als sozialrealistischer Gangsterfilm beginnt, wird nach einer furios inszenierten Gewalteskalation bald zu einem epischen Portrait einer Frau, die, wie wohl alle nicht-privilegierten Chinesen, viel Mut, Geschick und Durchhaltevermögen aufbringen muss, um nicht unterzugehen im gnadenlosen Strom des gesellschaftlichen Wandels.
Wie so oft bei Jia spielt die Architektur eine große Rolle in diesem Film. Heruntergekommene, brutalistische Wohnblocks, gewaltige Betonklötze, ungeheure Staudämme. Die Einsamkeit der Masse und traurige schöne Menschen inmitten modernistischer Bauwerke – das kennen wir schon aus den Meisterwerken von Michelangelo Antonioni wie von seinem Berliner Schüler Christian Petzold, und ist auch tragendes Element der Filme von Jia Zhang-ke.
Wunderschön fotografiert und gelegentlich auch humorvoll eröffnet uns Jia wieder eine ansonsten eher verschlossene Welt. Schade, dass dem Film im letzten Drittel etwas die Luft ausgeht. Trotzdem ist „Ash Is Purest White“ einer der schönsten Filme des Festivals.
—————————————————–