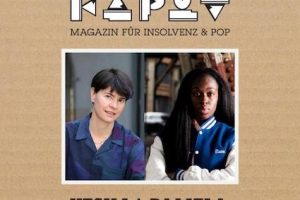Martin Hossbach: „Ich habe ein großes Sendungs- bewusstsein, denn wenn man schon Musik hört, dann kann man wenigstens interessante Musik hören“
Der Name Martin Hossbach ist das Multi-Trick-Pony der deutschen Musikszene und steht nicht nur für die eigene Schallplattenfirma (mit diversen Sublabelsträngen), sondern dient Martin Hossbach auch als Qualitätssignatur für Journalismus (SPEX), Booking- und Kuratorenjobs (Berghain, Pop-Kultur-Festival) und last but not least seine Tätigkeit als Musikberater für Spielfilme.
Martin, gibt es den einen ersten Song im Leben des Martin Hossbach?
Das große Aha-Erlebnis war „West End Girls“ von den Pet Shop Boys, das ich mit zehn Jahren im Fernsehen gesehen habe, ein Auftritt in einer Sendung von Peter Illmann. Ein ganz einschneidender Moment – so anders als alles andere, was ich zuvor gesehen hatte. Es gab damals noch kein MTV und VIVA, Musikvideos, aber es gab eben Auftritte von Popgruppen in Unterhaltungsformaten im Fernsehen. Dass da zwei Typen standen, die nicht viel machten und dass da jemand eher sprach als sang, das hat mich total umgehauen. Ich würde soweit gehen: hätte ich damals das nicht gesehen, würde ich heute nicht hier sitzen.
Wenn ich putze oder mein Fahrrad repariere, in Momenten der Langeweile und Kontemplation kommen mir Schlager in den Kopf. Das hat damit zu tun, dass meine Mutter immer NDR1 Welle Nord in der Küche hörte, ein Schlagersender für Norddeutschland. Ich habe unendliche viele Melodien von Künstler:innen wie Nicole, Udo Jürgens und Nana Mouskouri im Kopf, auch sie gehören zu meiner frühen musikalischen Prägung.
Die Pet Shop Boys lösen bei uns allen emotionale Teenagererinnerungen aus. Sie haben uns früh gelehrt, dass Pop und Biographie eine Beziehung zueinander haben. Was mich zu deiner Art bringt, wie du die Neuigkeiten aus deinem Hause in den Sozialen Medien anmoderierst. Du teilst Geschichten, die du mit deinen Künstler:innen erlebt hast, das gilt sowohl für das Label als auch das Pop-Kultur-Festival. Entspricht das deinem Wesen oder steckt da eine Strategie dahinter.
Es ist eine Mischung. Ich springe kurz zurück: Ich habe eine Industriekaufmannlehre bei PolyGram, heute Universal, gemacht und parallel auf einer sogenannten Wirtschaftsakademie BWL studiert; später habe ich dann in der Marketing-Abteilung von Universal Classics gearbeitet und mich um die Klassiklabels Deutsche Grammophon, Decca und Phillips gekümmert. Irgendwann habe ich bemerkt, dass mir die Arbeit keinen Spaß mehr bereitete, weil die Geschichten, die es da zu erzählen gab, nicht die meinen waren, sondern von extrem versierten Interpreten: Anne-Sophie Mutter oder Piere Boulez – wobei Boulez ein schlechtes Beispiel ist, mit ihm war es ganz toll. Aber ich hatte grundsätzlich mit Künstler:innen zu tun, die Musik spielten, die in den meisten Fällen vor mehr als 100 Jahren erschienen war. Die Geschichten dazu waren letztlich uninteressant: »Ich wollte es auch mal spielen«, »es ist ein wichtiges Werk von Beethoven« – es mangelte an echten Geschichten, so dass es mir schwer fiel, mich damit zu identifizieren. Doch wenn man im Marketing arbeitet, sollte man möglichst von den Produkten überzeugt sein.
Bei meinem Label ist es so, dass ich, abgesehen von Tara Nome Doyle, mit den Künstler:innen kaum etwas verdiene. Es muss mir also mindestens Spaß bringen – und das ist nur der Fall, wenn eine persönliche Beziehung besteht.
Ich weiß natürlich, was gut funktioniert auf Instagram und was nicht. Bei manchen Posts riskiere ich, dass sie nicht so viele Likes bekommen, aber ich bin mir bewusst, wie ich ihn verfassen muss, damit er gut ankommt. Nichts davon ist erlogen, alles wurde erlebt – ich verstehe mich gut mit Musiker:innen, besser als mit anderen Berufsgruppen. Ich poste meistens früh morgens, gleich nach dem Aufstehen. Es ist eine Art Tagebuch für mich.
Das mit dem Tagebuch ist tatsächlich ein Gedanke auch von mir beim Verfolgen deiner Posts gewesen. Man kann anhand ihrer die Genese des Labels und Erlebnisse mit den Künstler:innen en Detail nachlesen. Ist es somit auch dein Notizzettel für die irgendwann sicherlich kommende Biographie?
Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber: ja. Bei dem, was ich erzähle, geht es größtenteils um das Label, insofern habe ich keine Probleme damit das als öffentliches Tagebuch zu sehen. Natürlich habe ich auch mal schlechte Laune, und natürlich läuft auch nicht alles super, diese Art von Tagebuch würde ich nicht öffentlich führen.
Was ich sonst auch noch gerne mache: Ich schreibe über Sachen, die es noch nicht gibt, und dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe, muss ich es machen.
Ich möchte kurz auf den Aspekt der Selfies kommen. Das sind bei dir eher „Wir-Selfies oder sogar „Sie-„ oder „Er-Selfies“. Dein Bild dient als Anreiz, um über jemand anderen zu erzählen und eben keine Ich-Ich-Ich-Selfies.
Das ist schön, dass du sagst. Aber gleichzeitig wär ich schon gerne Popstar geworden, ich wär gerne der dritte Pet Shop Boy, ich würde wahnsinnig gerne Musik machen, aber ich bin wahnsinnig unbegabt, was das betrifft. Ich kann Klavier spielen, aber auch wirklich nur nach Noten, ich kann nicht improvisieren, nicht komponieren.
Es geht aber auch um mich, sonst hätte ich das Label nicht nach mir benannt – für mich ist es der einzig ehrliche Name. Natürlich hatte ich zunächst überlegt, welche coolen Pet- Shop-Boys-Songtitel es gibt, nach denen ich das Label benennen könnte, das fand ich aber dann doch langweilig. Ich bin Einzelkind, es geht mir also schon oft um mich. Ich versuche mein Gesicht und meinen Namen einzusetzen, um, mal durch die Hintertür, mal nicht durch die Hintertür, Musik zu veröffentlichen, von der ich finde, dass sie gehört werden könnte.
Bei Handwerksbetrieben ist es ja gang und gebe, dass der Name des Handwerkers der Firmenname ist. Das legt den Gedanken nah, dass du sehr funktional an das Label herangehst, was ja aber nicht der Fall ist.
Als ich bei den Songtiteln nicht fündig wurde, kam ich auf Jil Sander, Giorgio Armani, Raf Simons, also auf Modelabels – da ging mir ein Licht auf: Da geht es um eine persönliche Handschrift, also heißen diese Labels so wie die Leute heißen. Außerdem mag ich meinen Nachnamen, er ist lang und ein Bach ist drin.
Martin, kannst du das Verhältnis aus inhaltlicher Arbeit und Marketing Arbeit benennen? Ist das 50/50?
(Frage inspiriert von Tanja Godlewsky)
Da ich ja mit dem Label so gut wie kein Geld verdiene, kann Marketing bei mir nur heißen: Ich bekomme jemanden dazu, über eine Platte zu schreiben oder mir eine Plattform zu geben, auf der ich bestimmte Künstler:innen platzieren kann, ohne dafür Geld auszugeben.
Marketing und PR sind meine hauptsächliche Arbeit, PR noch mehr als Marketing, diese Art von Öffentlichkeitsarbeit, die ich nur machen kann, da ich schon so lange dabei bin und viele Kontakte besitze.
Wenn du mit ›inhaltlich‹ die Arbeit an der Musik mit einer Künstler:in meinst, da ist es so, dass ich den Leuten totale Freiheit lasse – was wiederum auch mit Geld zu tun hat, da ich, abgesehen von Tara Nome Doyle, in die Produktionen nicht finanziell involviert bin, die ich veröffentliche. Die Künstler:innen produzieren ihre Musik selber oder mit Fördermitteln, wo ich allerdings manchmal beim Antragsschreiben helfe. Ich bin nicht derjenige, der sagt, „dass du dich auf deinem neuen Album mit Blumen beschäftigen willst, ist aber ein bisschen langweilig, willst du nicht lieber Bäume anstatt Blumen nehmen.“ Ich halte mich auch bei Pressefotos und Covermotiven raus, es sei denn ich werde gefragt, dann sage ich klar was ich finde.
Die Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, produzieren immer Inhalte, die mich interessieren, was daran liegt, dass ich die Menschen interessant finde. Meine hauptsächliche Arbeit ist es, das in Formate zu übertragen, die ich veröffentlichen kann. Dann beginnt die eigentliche Arbeit.
Ich würde nochmals gerne zu dem Punkt zurück kommen, dass du selbst gerne Popstar geworden wärst. Hast du es denn Mal probiert?
Ja, in den frühen Neunzigern, mit einem Freund aus Leipzig, Jan Hahn, heute ist er Fernsehmoderator. Da gab es eine Band namens Injection Calmante, die Musik stammte mehr oder weniger ausschließlich von Jan. Und dann mit meinem Freund Markus Engel, der mittlerweile bei der Initiative Musik arbeitet und das Pingipung-Label in Lüneburg mitgegründet hat, mit ihm hatte ich eine Band namens Ach so!, mit Ausrufezeichen. Diese Musik klang ein bisschen nach frühen Depeche Mode, obwohl ich die gar nicht so mag – instrumentale New-Wave-Musik, niemand von uns konnte singen. Es hat Spaß gemacht, aber ich hatte keine Lust mich in die Programme und Geräte reinzufuchsen und saß immer nur daneben und kommentierte.
Du hast vorhin die Lehre bei der PolyGram erwähnt. Dein Einstieg in die Musikbiographie war also ein Job-Job. Man kennt viele, die eher über Identifikationsmomente den Einstieg gefunden haben, bei denen Geld noch keine Rolle gespielt hat, und dann erst zur Berufsbiografie gefunden haben. War das damals eine aktive Wahl oder schwirrte die alternative Biografie, also im Pudel beispielsweise lange genug an der Theke stehen bis man ein Praktikum bei Lado bekommt, um dann irgendwann bei Universal zu landen, gar nicht zur Disposition?
Es gab eine Art Indie-Einstieg, vorher. Ich habe 1993 bei einem Konzert der Kastrierten Philosophen – 1995 habe ich Abi gemacht, die Lehre hat 1997 begonnen – den Journalisten Max Dax kennengelernt. Er hatte eine Jacke getragen, die ich toll fand und auf die ich ihn angesprochen hatte. Er publizierte damals in Hamburg ein kostenloses Konzertmagazin namens Sonic Press. Ich begann dann für ihn zu schreiben. Das Büro war auf St. Pauli in der Ditmar-Koel-Straße, neben dem von PIAS und Freibank, einem Label und einem Verlag, damals waren wir natürlich viel im Pudel. Was ich wusste: Ich wollte nicht studieren, ich hatte Lust, gleich zu arbeiten. Es gab damals das Hamburger Modell, eine Mischung aus Lehre und Studium. Ich bewarb mich also in allen Industrien, die mich interessieren: bei Holsten (Alkohol), Axel Springer und Gruner + Jahr (Presse) und PolyGram (Musik). Vorstellungsgespräche hatte ich bei allen, gehen hätte ich sonst noch können zu Gruner + Jahr. Aber als PolyGram sagte, dass ich dort anfangen könne, da ging mir ein Licht auf, nämlich dass die Musikindustrie doch die Industrie ist, die mir am nächsten steht und in der ich mich als Fan schon so lange rumgetrieben hatte. Die Arbeit bei Universal führte später dazu, dass ich, als ich im Jahr 2003 kündigte, wusste, dass ich nicht mehr bei einem großen Label arbeiten wollte. Bis zum eigenen Label dauerte es dann aber bis 2012.
Eine Hemmschwelle vor den großen Konzernen hattest du aber nie? Bei Springer sich zu bewerben, das wär bei uns in der Clique nie eine Option gewesen, das war der Feind.
Mir gefiel der „Marsch durch die Institutionen“-Spruch immer gut. Unis, Major-Plattenfirmen, alle müssen unterwandert werden. Die Leute, die auf diese Großunternehmen schimpfen, vergessen immer, dass es da auch coole Leute gibt. Ich habe schnell gemerkt, dass diese in der Jazz- und Klassikabteilung saßen – damit meine ich Leute, mit denen man sich gut unterhalten konnte und die auch eine kritische Position zu dem Unternehmen haben. Man darf auch nicht vergessen, Universal war damals ein interssantes Label – mit Tim Renner als Motor-Chef. Andreas Dorau lief da immer rum und hat sich um Musikvideos gekümmert, mit Ladomat vertrieben sie ein cooles House-Label… Wenn ich einen Tipp geben darf: ruhig in eklige Strukturen eintauchen!
Wobei du den Weg andersherum gemacht hast: du hast dich nicht wie andere im Lauf der „Karriere“ ergeben und bei Springer angefangen, sondern hast dich konträr von den Großkonzernen im Verlauf abgewendet. Zum Beispiel hin zur SPEX, wieder in Zusammenarbeit mit Max Dax. Du warst da einerseits als Journalist und Teil der Redaktion tätig, andererseits auch strukturell eingebunden und hast dich beispielsweise um die CD-Beilage gekümmert. Würdest du sagen, dass du jemand bist, der sehr situativ seinem Instinkt folgt und dann eben in eine Redaktion geht, wenn das Angebot kommt, obwohl es davor den Plan nicht gegeben hat?
Ich hätte nie gedacht, dass ich Redakteur bei einer Zeitschrift werde, SPEX war vom Renommee eine große Sache… Das mit dem Instinkt stimmt. Die Verbindung zum Max gab den Ausschlag. Ich habe eine Rolle eingenommen, die mir sehr liegt: einerseits zu organisieren, ich war der Chef vom Dienst, und dann habe ich ausschließlich Interviews geführt. Max brauchte jemand, der ihm Sachen abnimmt und den Rücken frei hält, und da wir schon so lange befreundet waren, ging das gut. Ich hörte dannn im Jahr 2010 auf, als ich dachte, es sei für mich auserzählt. Ich lernte damals die Betreiber des Berghain kennen, die einen bis heute kaum genutzten Teil ihres Hauses, eigentlich sind es zwei Häuser, die Rücken an Rücken stehen, strategisch entwickeln wollten und die jemanden suchten, der ihnen dabei half. Da habe ich einfach gesagt: „Das kann ich machen!“ Insofern ja, mein Instinkt spielt eine große Rolle.
Das bedeutet auch dass du keine Angst vor Herausforderungen hast. Das war ja keine kleine Aufgabe, in dem Techno-Club schlechthin einen neuen Konzertsaal strategisch zu etablieren und dann auch noch die Bookinglinie zu definieren. Hast du das Urvertauen, dass man mit Leidenschaft alles hinbekommen kann?
Das gute im Berghain war: Die Leute, die mich angestellt haben, haben das selbst als Herausforderung gesehen. Alle Beteiligten hatten das noch nicht gemacht, das hat den Druck auf alle Schultern gut verteilt.
Das Ergebnis meiner Projektarbeit war damals, dass es zu teuer geworden wäre, diese Halle als Konzerthalle für 3000 Menschen umzubauen. Heute finden dort ab und an Ausstellungen statt, Klanginstallationen, spezielle, eher kleinere Projekte.
Martin, manchmal gab es es härtere Brüche in deiner Biographie, manchmal fühlte sich eher wie ein natürlicher Flow an – beispielsweise vom Berghain dann zum Pop-Kultur-Festival.
Die Arbeit im Berghain zu beenden war schon traurig, ich hätte das Projekt gerne umgesetzt. Was ich im Berghain gelernt hatte, war das veranstalten von Konzerten – zusammen mit einem Kollegen hatte ich mich parallel zu der Projektarbeit für die Halle um das Konzertprogramm vor Mitternacht und unter der Woche, im Berghain selber und der Kantine am Berghain gekümmert. Insofern lag die Festivalarbeit nah.
Du hast das Pop-Kultur-Festival in diesem Jahr verlassen. Da du sechs Jahre involviert warst, würde ich gerne ein bisschen was dazu fragen. Ihr habt Euch damals trotz großer Kritikwelle (von wegen Staatsfestival) schnell als sorgfältig kuratiertes Festival etabliert. Wie hast du die Aufbauarbeit bei einem Festival mit guten Mittelbackground empfunden?
Ich dachte zu Beginn, es sei ein leicht zu ordnendes Feld. Mit dem damaligen Etat von glaube ich 700.000€ war klar, dass man etwas gutes machen konnte, durch die Beziehung zum Berghain war es möglich, die erste Ausgabe dort stattfinden zu lassen. Insofern: Geld, Ort, und die Ideen – beispielsweise Auftragsarbeiten zu vergeben – stimmten mich zuversichtlich. Die erste Ausgabe war sehr erfolgreich, nicht zuletzt wegen des Berghains – das wir aber auch ein bisschen gegen den Strich gebügelt hatten für drei Nächte, als beispielsweise Reggae in der Panorama Bar lief. Im zweiten Jahr gab es dann Gegenwind von Menschen, die wie ich in Neukölln lebten, und meinten, dass wir mit der Staatsknete den Stadtteil gentrifizieren und uns mit seinem coolen Image schmücken würden, weil wir das Festival dezentral an verschiedenen Orten in Neukölln ausrichteten. Meine Absicht war das Gentrifizieren nicht. Wir mussten immer wieder – zu Recht – die Diskussion führen, ob man Steuergelder benutzen sollte für ein Festival, wo Bands spielen, die auch sonst in Berlin spielen und von örtlichen Veranstaltern auf die Bühnen gebracht werden, die damit ihr Geld verdienen. Ich hätte das Festival gerne noch extremer ausgerichtet, so dass es diese Einwände gar nicht hätten geben müssen. Ich hätte das Festival gerne so ins Extrem getrieben, dass allen klar gewesen wäre, dass das nur mit staatlicher Unterstützung funktionieren kann. Und dann kam im Jahr 2017 der Boykottaufruf des BDS…
Auf beides habt ihr reagiert. Ihr habt die Kritiker:innen teilweise einbezogen – das Gegenfestival quasi ins Haus geholt, der alte soziologische Trick – , noch mehr aufwendige Auftragsarbeiten an Künstler:innen wie Pan Daijing und zur BDS-Thematik Paneldiskussionen ausgerichtet und klar Haltung bezogen. Ihr habt die Konflikte nicht unterdrückt, sondern zur Debatte gemacht.
Das war total lehrreich. Ich wäre von selbst nicht drauf gekommen, wir haben das gemeinsam erarbeitet. Das eigene Handeln zu Hinterfragen – gerade wenn man mit staatlichen Geldern hantiert –, das habe ich auf jeden Fall bei Pop-Kultur mehr als gelernt.
Wie verhält es sich bei der Programmierung eines solchen Festivals denn mit der Gewichtung aus etablierten Künstler:innen und Newcomer:innen?
Wir hatten ungefähr zehn Venues – und am Anfang ein leeres Blatt und eine leere Excel-Tabelle mit den Räumen und den Slots angelegt. In den größeren Räumen stellt man unbekannte Acts grundsätzlich an den Anfang, versucht aber immer mal wieder einen auch zwischen die bekannteren zu positionieren. Und dann gab es Entdeckungsräume, wo wir nur Acts platziert haben, die niemand kannte – und diese dann über Marketing und Pressearbeit im besten Fall zu interessanten Räumen aufzubauen.
Der Postbote klingelt. Das ist insofern von Interesse als dass wir danach über die Lieferung sprechen werden.
Guck mal! Das ist die Biografie von Pete Waterman, der in den 1980er Jahren ein Drittel von Stock Aitken Waterman war und verantwortlich für Kylie Minogue, Jason Donovan, Westlife, Rick Astley, Steps… ich will mich jetzt fortbilden in Sachen Management.
Da sind wir ja schon bei der Anmoderation deines Weggangs vom Pop-Kultur-Festivals. Du hast es bereits angedeutet, die Entscheidung hatte viel damit zu tun, dass es ein rein digitales Festival in 2020 war – dass ihr mit dem TV-Show-Prinzip zwar super umgesetzt habt, es aber dennoch eben nicht the real thing war und das was du dir unter der Arbeit bei einem Festival vorstellst, das Arbeit mit Künstler:innen vor Ort. So ist es ja ein ganz anderer Job.
Am meisten Spaß bei der Programmierung haben mir immer die Auftragsarbeiten gebracht. Die hatte ich, als Idee, von Matthias von Hartz’ „Foreign Affairs“-Festival, das ich zuvor mitkuratiert hatte, eingebracht. Wir waren damals die ersten, in Deutschland, im Popbereich. In England gab es das beispielsweise im South Bank Centre mit Squarepusher, Aphex Twin und anderen Warp-Künstler:innen, die mit der London Sinfonietta zusammenarbeiteten, kuratiert von Glenn Max.
Die Kunst des Festivalmachens ist ja nicht nur dem eigenen guten Geschmack zu folgen, sondern es so aufzubauen, dass es vielen Leuten gefällt. Das ist uns ab 2017 sehr gut gelungen. Zu sehen, wie sich Menschen auf dem Festivalgelände bewegen und dass sie sich Künstler:innen anschauen, die sie noch nicht kannten, die teilweise noch nichtmal jemand in deren Heimatland kennt, das hat mich immer sehr befriedigt. Das Festival über Zoom zu organisieren und im Internet auszuspielen, das ist zwar gut geworden und vielleicht kriegen wir dafür auch noch den Grimme Preis, aber mich hat die Arbeit nicht froh gemacht. Mir war die Zukunft, das Jahr 2021, zu unsicher, ich wollte mich befreien und weniger vor Zoom sitzen.
Pop-Kultur war nicht meine einzige Einnahmequelle, aber schon die wichtigste. Ich muss nun schauen, wo das Geld in Zukunft her kommen kann. Ich mach jetzt ein zweites Studium Zuhause und lese viele Autobiografien von erfolgreichen Menschen aus der Musikindustrie. Die Idee ist, mich auf Tara Nome Doyle zu konzentrieren, ihr und ihrer Musik mehr Zeit zu widmen und das im Jahr 2022 erscheinende zweite Album generalstabsmäig vorzubereiten.
Ein mutiger Schritt, gerade im Corona Jahr. Aber du hast ja noch ein weiteres Berufsfeld: Die Beratung und Zusammenstellung von Filmsoundtracks.
Als Azubi bin ich im Jahr 1999 drei Wochen lang bei Universal Music in der Verlagsabteilung gelandet. Verlage sind vor einigen hundert Jahren entstanden als es um die Vervielfältigung von Noten ging, damals die einzige Form der Verbreitung von Musik. Heute kümmern sie sich hauptsächlich um das Verwalten des Urheberrechts an der Komposition, wobei das Label meistens das Recht an der Aufnahme hat.
2004 hat mich der Regisseur Ulrich Köhler angesprochen, ob ich ihm helfen könne, ein Stück der Pet Shop Boys für seinen Film „Montag kommen die Fenster“ zu klären“. Er hat mich dann gefragt, ob ich nicht andere Szenen in dem Film auch noch mit Musik ausstatten möchte. Mittlerweile habe ich knapp über 70 Kinofilme betreut, alles deutsche Produktionen, zum Großteil die sogenannte Berliner Schule. Der erfolgreichste Filme bislang war „Toni Erdmann“ von Maren Ade – der Film hat den Silbernen Bären gewonnen, war der Deutsche Beitrag zum Oscar, lief als erster deutscher Film seit Ewigkeiten in Cannes im Wettbewerb. Eine Szene in dem Film ist besonderes interessant, weil die Schauspielerin, Sandra Hüller, ein Stück von Whitney Houston singt. Wenn jemand im Film singt, müssen die Autor:innen gefragt werden, ob das okay ist. Also haben wir die Version von Sandra Hüller und Michael Mühlhaus (von Blumfeld), der hinter den Kulissen Keyboard gespielt hat, eingeschickt, und ich durfte das Lizenzhonorar verhandeln. Ein ganz toller Job, von dem ich vorher nicht wusste dass es ihn gibt. Bislang habe ich das immer nur gemacht, wenn mich jemand gefragt hat, in diesem Jahr will ich aktiv bei Regisseuren und Produzenten Akquise betreiben.
70 Stück und das nebenher ist eine beeindruckende Zahl.
Kannst du kurz mal den Rahmen deutlich machen: Weviel Stücke muss man da im Schnitt so klären und was für ein Budget hat man zur Verfügung?
70 klingt viel – auf 16 Jahre gerechnet sind es aber nur vier, fünf Filme im Jahr. Da diese Regisseure hauptsächlich Musik im Film nur einsetzen, wenn sie auch wirklich vorkommt – sie arbeiten also nicht mit komponierten Score –, in einer Disco, im Auto, auf Kopfhörern… und diese Szenen rar gesetzt sind, sprechen wir von fünf bis 15 Szenen pro Film. Die Musikbudgets liegen zwischen 20.000€ und 70.000€, bei Gesamtbudgets zwischen 800.000€ und 6 Millionen€. Der Job wird schwierig, wenn die Regisseur:in sehr präzise Vorstellungen hat, aber nicht unbedingt große Repertoire-Kenntnisse, da bin ich dann sehr gefragt – was wiederum Spaß bringt, mehr Spaß als fest vorgeschriebene Musiken zu klären und einzukaufen. Der Regisseur Ulrich Köhler ist extrem, da muss ich schonmal für eine Szene mit Autoradio und 10 Sekunden Einsatzlänge locker 50 Songs vorschlagen – und dabei immer mit bedenken, ob wir uns den Song überhaupt leisten können. Denn wenn ich Madonna, Billie Eilish oder Jay-Z vorschlage, dann reicht das Geld nicht, dann gibt es keine Freigaben.
Wie oft hast du den idealen Song im Kopf und musst dir das vorschlagen selbst verbieten?
Selten, vielleicht ist das schon Berufskrankheit! Wenn sich ein:e Regisseur:in erstmal auf einen Song festgelegt hat und man den nicht bekommt, dann wird mein Job sehr schwierig.
Deshalb ist es auch schwer zu sagen, wie zeitaufwändig es ist. Bei einem Netflix-Film ging es vor kurzem sehr schnell: der Regisseur fand alles super, was ich vorgeschlagen habe, die Labels und Verlage machten Angebote, die man nur leicht nachverhandeln musste, die Produktion war sofort dabei – und ich habe anteilig relativ gutverdient. Meistens sind die Filme mit geringeren Budget jene, wo es lange dauert; das kann eine Stunde pro Tag bedeuten, mal auch nur eine Stunde in der Woche … man wartet oft auf Rückmeldungen oder braucht lange, um an Verlage heranzukommen, neulich hatte ich beispielsweise einen Fall im Kongo, da musste ich ewig recherchieren – da hatte ich am Ende einen wesentlich größeren Aufwand, vergleichen mit der Netflix-Produktion, aber nur ein Viertel der Bezahlung.
Wieviele Sachen klappen denn nicht?
Weil Verlage und Labels schon lange nicht mehr so hohe Umsätze mit Tonträgern machen wie in den frühen Nullerjahren noch, sind sie darauf gekommen, dass Musik in Filmen eine gute Einnahmemöglichkeit sein könnte. Den Künstler:innen und Urheber:innen geht es genauso. Was die Quote angeht: von 10 Anfragen klappt eine nicht. Wenn man das Geld hat, kann man sich viel kaufen: auch Bob Dylan.
Lass uns mal zu Martin Hossbach dem Label zurückkehren. Wird denn Tara Nome Doyle auf deinem Label erscheinen oder hat sie der Manager Martin Hossbach woanders hin vermittelt?
Vielleicht beim dritten Album, das zweite kommt noch bei mir raus, Stand heute. Ich hab schon vor dem ersten Album versucht ihr ein Majorlabel zu finden, da ich einen Minderwärtigkeitskomplex habe – »das Label mache ich doch alleine und da ist jemand, der so viel größer sein könnte oder auch werden wird, die ist doch bei mir gar nicht richtig«, so etwas dachte ich. Tara sieht das nicht so, sie fühlt sich bei mir wohl. Als ich sie das erste Mal live gesehen habe, wollte sie erstmal Abi machen und danach studieren, jetzt will sie Musikerin sein. Ich war damals bei A&Rs von Universal, Sony und so weiter – die haben alle gesagt: „Gut, aber mach doch selber“, „Gut, aber wir können die Aufbauarbeit nicht mehr leisten“, „Gut, aber die Songs sind noch nicht fertig“. Das letzte habe ich einfach ignoriert, da haben sich für mich Menschen disqualifiziert. Die anderen Antworten fand ich ehrlicher, die haben mir geholfen.
Ich hab beim ersten Album viel gelernt, Tara kann also guten Gewissens noch ein zweites oder auch ein drittes Album bei mir veröffentlichen. Letztlich ist es ja vor allem eine Frage des Geldes, damit mein ich Geld für Marketing und Pressearbeit. Wir haben eine Unterstützung von der Initiative Musik bekommen, mit der wir nun finanziell sehr gut ausgestattet sind. Ich habe bislang immer vorrangig Pop-Kultur und Musikberatung gemacht und alles andere nebenbei. Ich will jetzt mal versuchen, was dabei raus kommt, wenn ich das, was ich so nebenbei mache, ernster angehe. Ich wünsche mir, dass Tara und ich irgendwann von ihrer Musik leben können.
Was zeichnet dein Roster aus deiner Sicht aus? Gibt es ein Composing-Model oder entsteht die Vielseitigkeit, die einem da begegnet, eher aus dem Fluß heraus?
Bei Tara ist es Planung. Bei ihr ist es wichtig, dass ich mich dem Markt anpasse. Das Album kommt im Januar 2021. Das braucht Vorlauf, es wird drei, vier Singles geben, ich brauche die Zeit, um Medien und Handel davon zu überzeugen. Ich geh das an, wie ich es in der Lehre gelernt habe und wie es vielleicht in Management-Büchern steht.
Ansonsten entsteht das meiste auf dem Label aus dem Fluss heraus, ich plane nicht. Ich versuch es möglichst bunt zu machen, damit es mich bei Laune hält. Ich will immer offen sein für so spinnerte Ideen wie die von Max Rieger (Die Nerven, All diese Gewalt, Produzent von Ilgen-Nur und jetzt Casper), der in Quarantäne ein Black-Metal-Album unter dem Alias Obstler aufgenommen hat und sich dafür das Sublabel »Martin Hossbach Quarantäne“ gewünscht hat – das kann ich nicht planen, das muss ich aber machen.
Im Dezember hast du als Aktion in Berlin die Platten deines Labels direkt bei den Besteller:innen vorbeigebracht. Die Medien griffen das Thema auf – siehe Tagesspiegel. Haben das viele wahrgenommen?
Ich hab es schon im März 2020 gemacht, als Taras erste Tour unterbrochen wurde; auf Tour kaufen die Leute ja gerne Platten und CDs, das wollte ich nicht beendet sehen. Als ich mit der Aktion fertig war, habe ich Taras PR-Agentur davon erzählt und die beschwerte sich, dass sie das nicht vorher gewusst hatte, das sei ja »eine Superaktion für die Presse«. Im Dezember letzten Jahres habe ich das wiederholt mit dem gesamten Labelkatalog – ich habe diesmal vorab die Presse kontaktiert und alle haben das Thema aufgegriffen: Radio Eins, Flux FM, Berliner Zeitung, Tagesspiegel, der Rolling Stone auf Instagram… Ich habe am 22., 23. und 24. Dezember mit dem Rad ausgefahren – das waren so ungefähr 40 Tonträger, die von circa 30 Leuten bestellt wurden; knapp 600€ Umsatz. Ich könnte es nicht jeden Tag machen, es war sehr anstrengend. Aber es war ein guter PR-Stunt und hat viel Freude bereitet – mir und den Kund:innen.
Wieviele der Leute kanntest du?
Das Verhältnis war total gut, 70%-80% Leute, die ich nicht kannte. Das hat mir gezeigt, dass es auch Sinn ergibt, sich nicht nur auf die Medien zu beschränken, die man selbst liest.
Wie groß schätzst du die Community der Leute ein, die das Label Martin Hossbach kontinuierlich verfolgen?
Ich glaube, dass die meisten nicht wissen, wie die Firma heißt, die die Musik veröffentlicht, die sie da gerade hören – analog denke ich nicht, dass Fans von Tara den restlichen Katalog kennen. Ich weiß, dass solche Spässchen wie Obstler oder Künstler:innen wie Nicolas Fehr und Martha Rose es nicht jeder:jedem leicht machen, zumal von den 2000 Menschen, die mir auf Instagram folgen, die wenigsten jeden Tag dabei sind und alles mitbekommen. Aber meine Freunde interessieren sich schon für alles, was ich veröffentliche. Es macht mich glücklich, wenn jemand über ein Release des Labels dazu kommt, sich mit anderer, für sie neuen Musik zu beschäftigen.
Ist es etwas altmodisches einem Label zu folgen? Ich mach das noch immer, sie funktionieren wie gute Kurator:innen für mich, die einen mit Musik konfrontieren, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Die wenigsten Menschen interessieren sich für Labels.
Taras Album wurde in der Brigitte und der Missy besprochen – wenn die Leser:innen nun auf meinen Instagram-Account schauen, dann weiß ich nicht, was die sich denken. Ob sie dabei bleiben? Viele Musik, die ich veröffentliche, hatte mit Taras fast schon klassischem Singer-Songwriter-Soul-Pop wenig zu tun. Ob sie den Weg zu Obstler mitgehen? Ich weiß es nicht.