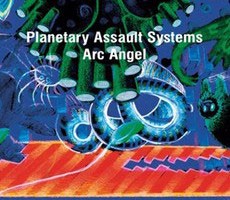“Auf jeden Fall kein 0815-Zeug.”
Im Februar diesen Jahres fand in Dortmund der von Jonas Eickhoff initiierte eintägige Kongress “Electronic Body Music. Ordnung in und als Bewegung” statt, bei dem in zahlreichen Vorträgen und anschließenden Diskussionsrunden soziologische sowie kultur- und sozialanthropologische Perspektivnahmen auf die Subkultur beziehungsweise Szene elektronischer Tanzmusik öffentlich zur Diskussion gestellt wurden.
Mit “Electronic Body Music” ging es Eickhoff darum, “Korridore zwischen Sozialwissenschaftlern, die das Feld der elektronischen Musikszene beforschen, und der untersuchten Szene selbst auszuleuchten, auszuloten und auszuhandeln.” Ziel war es dabei nicht Grenzen aufzulösen, sondern vielmehr ging es darum, diese “explizit zu thematisieren, um sich dadurch selbst jeweils (anders) zu reflektieren.” Im Anschluss an den Kongress veröffentlichen wir auf Kaput peu a peu Gespräche mit den Vortragenden und kontextuell passenden weiteren Autor_innen und Sozialwisenschaftler_innen. Heute mit Dr. Nora Friederike Hoffmann.
Dr. Nora Friederike Hoffmann, können Sie, um sich selbst vorzustellen, kurz skizzieren, welche Forschungsschwerpunkte Sie derzeitig haben?
Ich arbeite aktuell an der FernUniversität Hagen und habe dort sehr viel mit Fernstudium und Lehre zu tun. Meine Forschungsschwerpunkte sind anzusiedeln im Bereich der rekonstruktiven Erforschung, insbesondere von sozialer Ungleichheit. Das heißt ich beschäftige mich damit, was verschiedenen Menschen Dinge ermöglicht oder verwehrt. Das Ganze vor allem im Zusammenhang mit Jugendszenen. Zudem forsche ich mit qualitativen Forschungsmethoden und mit der praxeologischen Wissenssoziologie als Grundlagentheorie. Aktuell bewege ich mich aber eher in die Richtung von raumtheoretischen Forschungsprojekten.
Ihre Dissertation, die sie 2014 verteidigt haben, wurde im vergangen Jahr unter dem Titel „Szene und soziale Ungleichheit. Habituelle Stile in der Techno-/Elektro-Szene“ als Buch publiziert. Können Sie Ihren entsprechenden Forschungshintergrund näher rekonstruierend skizzieren? Warum dieses Feld? Welcher Zugang? Welches Vorwissen hatten Sie zu dem Feld elektronischer Tanzmusik? Also welcher Zugriff auf das Feld? Auch methodisch.
Hoffmann: Also ich habe mich diesem Feld, mehr oder weniger, aus drei Richtungen genähert.
Während meines Studiums der Erziehungswissenschaft in Halle habe an einem Forschungsprojekt gearbeitet, in dem wir sehr viele Jugendliche in unterschiedlichen Bundesländern in Deutschland mittels teilnehmender Beobachtung und Gruppendiskussion und Interviews beobachtet haben. In diesem Zusammenhang bin ich auf eine Gruppe junger Männer gestoßen, die in der Kultur des Hip-Hops verortet waren. Mich interessierte die Frage, wie diese in ihren relativ jungen Jahren sich dieser Jugendkultur annähern und zugehörig fühlen. Während dieser Beschäftigung mit dem Thema Jugendkultur, Szene beziehungsweise Subkultur ganz allgemein, ist mir aufgefallen, dass in diesem Themenbereich Fragen sozialer Ungleichheit immer weiter ausgeklammert worden sind. Man kann davon ausgehen, dass in den 60er-Jahren eine jugendliche Vergemeinschaftungsform eher als Subkultur wahrgenommen wurde als heute, das heißt, dass sie mit einem bestimmten Klassenparadigma beschaut wurde, da man damals davon ausging, Subkulturen stellen immer eine generationsspezifische Verarbeitung klassenspezifischer Problemlagen dar. Mit der Veränderung des theoretischen Zugangs, also dem Erstarken der Individualisierungsthese nach Ulrich Beck, hat sich immer weiter herauskristallisiert, dass diese Bezüge zu sozialen Ungleichheiten marginalisiert worden sind, bis sie dann mehr oder weniger im Szenekonzept, was Ronald Hitzler und andere Ende der 90er-Jahre entwickelt haben, fast vollständig verschwunden sind. Das war sozusagen ein gegenstandstheoretischer Bezug, den ich da hatte.
Dazu kam als zweite Zugangsebene das grundlagentheoretisches Paradigma, die praxeologische Wissenssoziologie, die sich in den 1980er und 90er Jahren in Anlehnung an Karl Mannheim, vor allem ausgearbeitet von Ralf Bohnsack, Arnd Michael Nohl und anderen, entwickelt hat. Man geht mit dieser praxeologischen Wissenssoziologie davon aus, dass man zwei verschiedene Formen des Wissens und der Erfahrung voneinander unterscheiden muss. Einerseits eine kommunikative Ebene – eine bestimmte Form von Wissen, das man leicht explizieren kann – und eine Ebene des Konjunktiven Wissens, das aus einer ähnlich erfahrenen Praxis hervorgebracht wird und welches sich auch in gemeinsamen Praxen reproduziert. Ich hatte den Eindruck, dass diese Ausklammerung von Aspekten sozialer Ungleichheit daher rührt, dass von der Beforschung die kommunikative Ebene, die an der Oberfläche bleibt und deskriptiv angelegt ist, eher gewählt wird.
Dieser Eindruck kam aus meinem dritten Zugang: Ich war selber relativ häufig unterwegs im Nightlife, wie es Gunnar Otte bezeichnen würde, und machte dort alltagsempirische Beobachtungen. Ich hörte dort immer wieder Sachen wie: „Och, die Party ist aber blöd hier, es sind zu viele Atzen da“. Ich hatte den Eindruck, dass es auch innerhalb der Technoszene, die zum Beispiel von Ronald Hitzler als sehr offen und als Möglichkeitsraum für alle dargestellt worden ist, dass es auch dort bestimmte Abgrenzungen gibt, die etwas mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen zu tun haben. Also, dass es zwar schon Parties für allemöglichen Menschen gibt, diese aber an unterschiedlichen Orten stattfinden.
Aus diesen drei Bezugslinien hat sich dann mein Thema ergeben. Ich habe eine wissenschaftlich-theoretische Einschätzung dessen zugrunde gelegt, was Szene ausmacht, nämlich die Unabhängigkeit von Klasse und Schicht, die Möglichkeit sich aus solchen Bezügen herauszulösen – und dies mit theoretischen Bezugnahmen auf die phraseologische Wissenssoziologie gekoppelt, die sagt, ja, es mag sein, dass auf einer kommunikativen Ebene, das so angenommen wird, wenn man sich aber die Praxen der Menschen anschaut, ist das aber vielleicht noch einmal anders. Was sich mit meinen alltagsempirischen Erfahrungen deckte.

Sie haben es nun bereits indirekt selbst angesprochen: In Ihrer Dissertationsschrift entwerfen Sie die Perspektive eines ungleichheitsorientierten, eines praxeologischen Szenekonzepts. Könnten Sie Kernbereiche dieses Konzeptes skizzieren?
Also einerseits ist es so, dass die gegenstandstheoretische Ursprungsfrage meines Themas bei verschiedenen theoretischen Paradigmen, wie man jugendliche Vergemeinschaftsformen betrachten kann, Ausgang nimmt. Es gab in den 1960er-Jahren ein klassenspezifisches Paradigma vom Centre for Contemporary Cultural Studies in Birmingham. Die haben 1979 eine sehr interessante Veröffentlichung herausgebracht: „Jugendkultur als Widerstand“. Grundlage dieses Konzepts ist, dass die damals existierenden Vergemeinschaftungsformen als Ausdruck von klassenspezifischen Problemlagen zu fassen sind. Dazu gehörte zum Beispiel bei den Skinheads die Ausstaffierung mit Insignien der Arbeitsklasse, aus der sie stammten, wie Springerstiefeln und Blue-Jeans. In den 1980er-Jahren hat Ulrich Beck ein Buch veröffentlicht, das in der Sozialwissenschaft eingeschlagen ist wie eine Bombe: „Die Risikogesellschaft“. Eine der Thesen dieses Buches ist es, dass die Menschheit vor dem Hintergrund globaler Risiken wie atomare Supergaus oder Umweltverschmutzung im Allgemeinen immer mehr zusammen rutscht. Die Unterschiede, die aus Klassen- oder Standeszugehörigkeiten herrühren, werden immer irrelevanter, weil wir alle gleichzeitig im gleichen Maße von saurem Regen, als plattes Beispiel, bedroht sind. Diese These ist vor allem in der Jugendforschung sehr häufig rezipiert worden und hat auch das Konzept der Jugendkulturen beeinflusst.
Anfang der 90er-Jahre wurde dann deutlich, dass sich die Idee durchsetzt in der Jugendforschung, dass Jugendliche die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Szene nach ihrem eigenen Interesse, ähnlich wie die Mitgliedschaft in einem Verein, frei wählen können. Und genau dieses Konzept wurde weitergeführt bis zur Ausarbeitung des Szenekonzepts nach Ronald Hitzler, Thomas Bucher und Arne Niederbacher, die dann Ende der 90er-Jahre ein Buch herausgegeben haben mit dem Titel „Leben in Szenen“, was sehr prägend war und wo Szenen als individualisierungssymptomatische Gesellungsgebilde beschrieben worden sind, als Prototyp posttradtionaler Vergemeinschaftung, die die Auslösung aus traditionellen Mileus-, Klassen- und Schicht-Kulturen ermöglichen. In diesem Moment war soziale Ungleichheit endgültig aus dem Konzept herausgelöst und man befand sich auf den Weg zur individualisierten Vorstellung von Gesellschaft.
Ich konnte nachvollziehen, dass, wenn man einen Blick auf Szenen wirft, sich dort ganz unterschiedliche Bevölkerungsschichten zusammenfinden, dass man also nicht mehr – wie es bei den Skins in den 70er-Jahren in Großbritannien war – , nur Menschen einer bestimmten Schicht vorfindet, sondern sich in einer Szene wie der Techno- und Elektro-Szene ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammen finden.
Meine Forschungsfrage war aber, ob es nicht (im Sinne von Bourdieu) trotzdem feine Unterschiede sozialer Praxis gibt,wie sich in einer solchen Szene bewegt wird und ob sich nicht über diese feinen Unterschiede auch wieder soziale Herkünfte repräsentieren und darüber eventuell auch soziale Ungleichheiten reproduziert werden.
Um noch ein wenig mehr Ihren Zugriff herauszustellen: Wie war der Feldkontakt? Auch explizit methodisch?
Ursprünglich begann meine Studie damit, dass ich mir vorgenommen hatte, nicht nur die Techno- und Elektro-Szene in den Blick zu nehmen, sondern diese als ein Beispiel für eine hedonistische Szene zu begreifen und zusätzlich dazu mich der Gewerkschaftsjugend zuzuwenden, die ich als ein Beispiel für eine aufklärerische Szene verstanden habe, die mehr oder weniger mit der Szenezugehörigkeit versucht eine „Verbesserung der Welt“ zu schaffen. Und schlussendlich auch noch die Streetball-Szene – eine Selbstverwirklichungsszene – in den Blick nehmen wollte, in deren Zusammenhang es darum geht, sich selbst als Person oder den eigenen Körper zu verfeinern und vervollkommenen.
Diese Unterscheidung von hedonistischer, aufklärerischer und Selbstverwirklichungs-Szene basiert auch auf einer Idee von Ronald Hitzler. Ich habe damals mit meinen Erhebungen in der Streetball-Szene begonnen und relativ schnell festgestellt, dass dieses Konzept, diese Unterscheidung in Hedonismus, Aufklärung und Selbstverwirklichung eigentlich kein Sinn für mich macht, weil deutlich geworden ist, dass das natürlich nicht so strikt getrennt werden kann, sondern allenfalls als analytische Trennung fungieren kann. Jemand, der sich in der Techno-Szene bewegt, der ist nicht zwangsläufig nur an Hedonismus interessiert, sondern auch dort gibt es viele Menschen, die das Ganze als eine Art der Selbstverwirklichung verstehen. Es gibt Bezüge zu politischen Gruppierungen, sodass das dann eher in Richtung Aufklärung gehen könnte.
Kurz und gut: Ich habe dieses Konzept, in dem ich mich relativ viel mit Streetballern beschäftigt und unterhalten habe, ad acta gelegt und habe mich hauptsächlich den Erhebungen in der Techno- und Elektro-Szene zugewandt – wobei ich einige Erfahrungen mit der Streetball-Szene mitgenommen habe. Ich forsche mit Gruppendiskussionen. Mein Ziel war es nicht, Menschen einen Fragebogen vorzulegen, sondern auf einen offenen Forschungszugang zu setzen. Konkret bedeutet dies, dass die Menschen, relativ breit angelegte Fragen gestellt bekommen und so die Möglichkeit besitzen, im Rahmen des Gesprächs selbst auf die Dinge einzugehen, die für sie selbst wichtig sind. Das Ziel ist es, dass ich mich als Moderatorin eher zurückhalte.
Diese Art und Weise zu Forschen bietet aber auch einige Barrieren. Das habe ich bei meinen Begegnungen in der Streetball-Szene festgestellt. Ich wollte keine Einzelinterviews führen, sondern Gruppendiskussionen, da ich der Meinung war, dass gerade das Sich-Bewegen in einer Szene ein gruppenhafter Prozess ist, der oft nicht individuell passiert, habe aber bei der Streetball-Szene festgestellt, wie kompliziert es ist, verschiedene Leute zu einem Zeitpunkt zusammenzubringen und Termine auszumachen.
Für meine Erhebungen in der Techno-Szene bin ich auf einschlägige Festivals gefahren. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben in verschiedene Städte zu fahren und auf Parties Menschen anzusprechen, aber man kann sich sehr gut vorstellen, wenn man auf einer Party ist, dann hat man überhaupt keine Lust, ein einstündiges Interview zu führen oder gar eine Gruppendiskussion. Auf den Festivals bin ich vor allem tagsüber über das Gelände gelaufen, wenn wenig Programm stattfindet und habe verschiedene Gruppen angesprochen – damit bin ich relativ erfolgreich gewesen. Ich habe im Anschluss an das Gespräche die Gruppen gebeten, dass sie sich so darstellen, wie sie wollen, dass ich sie sehe – mit den Möglichkeiten, die man hat sich Fotos direkt anzugucken, haben wir dann solange Fotos gemacht, bis die Gruppe gesagt hat, ja, genau so finden wir es gut. Ich habe die Gruppendiskussion und die Gruppenfotos im Zusammenhang miteinander analysiert; es ging dabei immer darum, wie der habituelle Stil dieser Gruppierung aussieht, wie sie mir als Forscherin gegenüber treten und welche Praxen sie in ihrem Handeln betreiben.
Dieser Festivalsommer war sehr spannend, aber natürlich auch sehr anstrengend, weil ich mich als jemand mit einem Arbeitshintergrund in einem totalen Freizeitumfeld bewegt habe. Am Ende des Sommers hatte ich den Großteil meiner Daten zusammen, die ich im Herbst und Winter mit Zusatzerhebungen gauf kleineren Parties ergänzte.
Wie sahen die Ergebnisse ihrer Studie aus?
Ich habe eine Methode verwendet, bei der es darum ging nicht einfach zu gucken, was die Leute sagen oder wenn man bei dem Foto bleibt, was die Leute tragen oder auf was für Stühlen sie sitzen oder in was für einen Raum sie sitzen. Sondern der Fokus dieser dokumentarischen Methode, die ich angewandt habe, liegt immer auf dem „wie“. Das heißt es geht letztendlich immer darum zu schauen, wie tragen sie ihre Kleidung, wie positionieren sie sich für das Foto, wie sitzen sie auf einem Stuhl, wie verhalten sie sich zueinander? Und es geht nicht darum, was sie über die Techno- und Elektro-Szene ihr Leben, die letzte Party sagen, sondern wie sie es erzählen.
Ich konnte drei verschiedene Typen von habituellen Stilen in der Techno-/Elektro-Szene rekonstruieren. So gibt es eine Gruppe von Menschen innerhalb der Szene, die sich in dieser mit einem ganz spezifischen Eigensinn bewegen, indem sie mit Normen und Stereotypen spielen und dabei – im Sinne der Selbstverwirklichung – eigensinnig auf der Suche nach sich selbst sind. Klingt ein bisschen esoterisch, so ist es allerdings nicht gemeint. Ein Beispiel hierfür sind Gruppen, mit denen ich ganz, ganz viele Fotosessions gemacht habe, bis irgendwann klar geworden ist, wie sie sich darstellen wollen. Gruppen, die sehr lang darüber debattiert haben, was eigentlich unter guter Musik zu verstehen ist. Sie gaben zu Protokoll, dass sie gar nicht so genau sagen könne, was sie für Musik hören, das es auf jeden Fall kein 0815-Zeug sei. Sie waren sich nicht so sicher, ob eine Szene, die so Mainstream ist, für sie überhaupt noch das Richtige sei. Sie sahen sich auf der Suche nach neuen Spielarten, um sich vom Mainstream abzugrenzen. Das Ganze zeigte sich auch, wenn die Gruppen davon erzählt haben, wie sie feiern. Sie brachen mit bestimmten Normen, Stereotypen und Konventionen, es ging darum, frei zu sein und den Moment zu nutzen.
Was kennzeichnet die beiden anderen Gruppentypen, die Sie identifizieren konnten?
Für einen anderen Typ steht genau der Mainstreamkonsum und die Unterhaltung im Zentrum ihrer Szenemitgliedschaft. Diesen Typ habe ich als Szenepublikum bezeichnet, dass sich mit vermittelter Szeneteilhabe auf den Festivals bewegt hat. Hier ging es vor allem darum, die Stilelemente des Mainstream zu affirmieren. Eine Passage aus einer Gruppendiskussion ist mir in Erinnerung geblieben: eine Gruppe sagte, sie höre gerne Techno, weil es ist gerade ziemlich angesagt, auch hier bei uns in der Region. Und wenn in zehn Jahren Volksmusik oder Heimatmusik in ist, dann würden sie halt das hören. Das ist ein große Kontrast zu den Gruppen des Typs Eins. Diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen bewegen sich beim Feiern vor allem mit einer Konsumhaltung. Es geht ihnen nicht darum, selbst etwas zu schaffen, Parties zu organisieren, neue Lokalitäten aufzutun, in denen man Feiern kann, sondern irgendwo hinzugehen, um dort mit Freunden Musik zu hören. Gleichzeitig sind sie sehr darauf bedacht, dass das eigene Feiern nicht die Ansprüche an ein Arbeitsleben konterkariert, das heißt man beginnt das Feiern erst nach Feierabend und man achtet sehr darauf, dass man am Sonntagabend zuhause ist, um sich regenerieren zu können.
Und dann gibt es noch so eine Art Mitteltyp, der auch recht interessant ist. Das sind nämlich diejenigen, die sich als zentrale Figuren in der Szene bewegen. Es sind Menschen, die in der Szene aktiv sind, indem sie selbst Parties organisieren oder als DJs unterwegs sind, die also Leistungen zur Verfügung stellen, von denen die Szene abhängig ist, weil sie sonst nicht funktioniert. Und bei diesen Gruppen ist ganz interessant, dass es ihnen gar nicht mehr darum ging, um ihrer selbst willen sich in der Szene zu bewegen, sondern sie haben sich in dieser Szene bewegt und diese als Mittel zum Zweck für Popularität und kommerziellen Erfolg verstanden. Konkret bedeutet dies, dass wenn diese Gruppen über Musik gesprochen haben, dann nicht im Sinne von etwas, was sie persönlich mögen, sondern es ging immer darum, dass sie diese Art von Musik verwenden konnten für ihre eigene Arbeit. Eine Gruppe, die viele Parties organisiert, geht selber nur irgendwo auf andere Parties, wenn sie sich DJs angucken wollen, die sie eventuell für ihre eigenen Parties buchen könnten. Wenn man nur Feiern geht, um sich DJs anzugucken, die man interessant findet und die man buchen möchte, ist es ähnlich wie bei der anderen Gruppe, von der ich erzählt habe, die davon spricht, dass es zu ihrem Selbstverständnis gehört, dass sie bis zum letzten Beat auf der Party sind , um zu zeigen, dass sie reale Szenenmitglieder sind. Diese Bemühungen real zu sein, können zu Konflikten mit der eigenen Authentizität führen.
Das sind die drei verschiedene Wege sich durch die Szene zu bewegen, die ich abstrahieren konnte in meiner Arbeit.
Was hat das denn jetzt eigentlich mit sozialer Ungleichheit zu tun und inwieweit werden dazu Bezüge deutlich?
Ein Moment ist es dass ich feststellen konnte, dass gerade dieses Über-die-Konventionen-Hinausgehen etwas damit zu tun, was für einen Berufs- und Bildungsstand die Menschen haben. Das heißt diejenigen, die mit Normen und Stereotypen spielen, kommen – zumindest in meiner Studie mit dem relativ kleinen Sample . eher aus einer Schicht, die man als Bildungsbürgertum bezeichnen könnte. Da hat es die qualitative Forschung schwerer als die quantitative Forschung, wie sie Gunnar Otte verwendet. Sie können die Menschen meistens sehr genau klassifizieren, weil sie das sehr genau erhoben haben. Ich kann für meinen Sample sagen, dass die Menschen, die Abitur haben und ein Studium verfolgen oder verfolgt haben, dass die eher in den Typen zu finden sind, die in ihren musikalischen Affinitäten und ihrer Feierpraxis über Normen und Stereotypen hinausgehen. Und diejenigen, die sich eher der Arbeiterschicht zuordnen lassen, die sind eher daran orientiert, bestimmte Normen und Konventionen, die gesellschaftlich vorhanden sind, zu befolgen.
Was man weiterhin sagen kann: Soziale Ungleichheit ist ein Thema, was sich selbst auch sehr stark verändert hat. Das war früher sehr strikt bezogen auf soziale Herkünfte und an Schicht oder Klasse orientiert, mit Bildungsabschlüssen, Stellung des Menschen im Produktionsprozess – mittlerweile gelten als Faktoren sozialer Ungleichheit auch einige andere Dimensionen darüber hinaus, wie zum Beispiel eine Migrationsgeschichte, das Leben in einer bestimmten Region und natürlich das Geschlecht.
Als ein relevanter Faktor sozialer Ungleichheit,die sich in der Szenepraxis nachvollziehen lässt, hat sich der Lebensort heraus kristallisiert. Nicht so sehr die Frage, ob man in Ost/West oder Nord/Süd lebt, sondern eher die Frage, ob man in einer urbanen oder eher ländlichen Region lebt.
Vergleicht man die Szeneforschung in der Techno-Szene der 90er-Jahre, wie sie zum Beispiel von Ronald Hitzler und Gabriele Klein unterhalten wurde, mit der Ihrigen, stellt sich mir die Frage, inwieweit sich die Szeneorganisationsformen unterscheiden? Wo liegen die Unterschiede der damaligen Fragestellung zur heutigen? Und leiten sich daraus Unterschiede in den Forschungsergebnissen ab?
Das ist eine gute Frage, die ich sehr schwer zu beantworten finde. Sie spricht ein Thema an, das sich Jugendforschern und Szeneforschern immer wieder stellt: Wir hinken mit der Forschung immer hinter her – die Dinge verändern sich so schnell, dass man in dem Moment, in welchem man zu seiner Aussage gekommen ist, die man veröffentlicht, der Lauf der Zeit häufig schon über das Geschehen hinweggerollt ist. Ich vertrete die Ansicht, dass es große Veränderungen gibt innerhalb der Szene, wenn man die 90er-Jahre vergleicht mit dem, was Anfang der 2000er-Jahre passiert ist und was aktuell passiert. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade meine Typologie von Szenetypen davon relativ unabhängig ist. Das ist aber eher ein Eindruck, den ich nicht verifizieren kann, weil ich nicht in den 90er-Jahren geforscht habe und mein Konzept nicht in den 90er-Jahren ausgearbeitet habe.
Mein Ansatz ist es ja, dass die Szeneforschung das Problem aufweist, sich in Deskription zu ergehen, sie bewegt sich In der Szene und versucht so bestimmte Charakteristika herauszuarbeiten und festzuhalten. Über solche Deskriptionen geht die Zeit sehr, sehr schnell hinweg. Bei mir geht es aber darum, zu fragen, wie sich die Leute innerhalb der Szene bewegen und in Abhängigkeit von welchen Einflüssen dieses Sich-Unterschiedlich-in-der-Szene-Bewegen passiert? Ich sehe hier verschiedene Einflussdimensionen – das war so schon in den 90er Jahren und das wird sos auch in zehn Jahren noch so sein, und zwar in allen Szenen.
Um das nochmals zu wiederholen: Wenn es nicht nur um die Deskription von Szenen geht, dann gleichen sich Szenen sehr stark. Sowohl unterschiedliche Szenen als auch die Techno-Szene in den letzten 20 Jahren. Es gab schon immer Unterschiede, wie man sich innerhalb einer Szene bewegt, aber die Szeneforschung hat sich diesen Unterschieden bisher nicht so dezidiert gewidmet.
Wie würden Sie das Verhältnis der Szene elektronischer Tanzmusik zu anderen Szenen wie der Hip-Hop-Szene und der Streetball-Szene definieren? Lassen sich Ihre Forschungsergebnisse auf andere Szenen beziehen beziehungsweise übertragen?
Ich sehe das Konzept nicht als limitiert an. Die Forschung hat zwar am Beispiel der Techno- und Elektro-Szene stattgefunden, aber die grundlegende Idee, die ich herausarbeiten konnte, dass es Gemeinschaften innerhalb von Szenen gibt, die ähnliche Praxen haben, was Bourdieu als feiner Unterschiede bezeichnen würde, ist übertragbar – wahrscheinlich würden sich die Typen, also diese Unterscheidung in Mainstreamkonsum/Unterhaltung, Popularität/kommerzieller Erfolg oder Spiel mit Normen und Stereotypen verändern.
Deswegen wäre es interessant andere Szenen in den Blick zu nehmen. Es gibt eine Arbeit von Wivian Weller zu HipHop in Sao Paulo und Berlin, die sie in den 90er-Jahren erhoben hat, wo sie feststellen konnte, dass es auch über die Landesgrenzen hinaus in Deutschland und Brasilien Ähnlichkeiten in der Art und Weise gibt, wie HipHop verstanden wird. Inwiefern das jetzt aber bei meinem Forschungsarbeit in der Techno- und Elektroszene gilt, also ob auch meine in Deutschland erhobenen Ergebnisse international übertragbar sind, vermag ich nicht zu sagen.
Vielen Dank für das Interview.