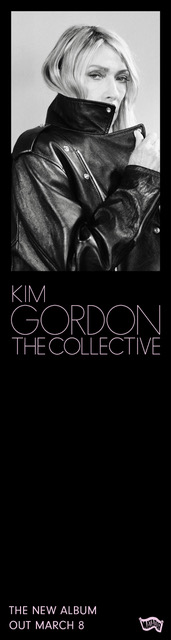Steve Albini – Last Man standing
Erinnert sich noch jemand an diese Szene aus der Stuckrad-Barre-Verfilmung „Soloalbum“, in der in einer absolut unrealistisch großen Redaktion einer Musikzeitschrift mit absolut unrealistisch vielen Mitarbeitern der Chefredakteur verkündet, dass das Magazin ein Oasis-Interview gewährt bekommt und einer die Band treffen wird? Ungefähr so, bloß noch hundertmal euphorischer freuten sich Felix Scharlau und Thomas Venker als nach fast einem Jahr im Frühjahr 2006 die Zusage kam, dass Steve Albini sie tatsächlich in seinem Chicagoer Electrical Audio Studio empfangen wird – und das auch noch mit Einladung zum von ihm gekochten Abendessen.
Audienzen bei Albini sind eine Seltenheit. Der Musiker (Big Black, Rapeman, Shellac) und Ausnahmeproduzent (die Liste ist lang und beinhaltet u. a. die Breeders, Pixies und Nirvana, um nur die Bekanntesten zu nennen) gilt als medienscheu, vor allem, wenn es sich um richtige Magazine (mit Anzeigen und so) handelt. Wenn schon, dann redet er lieber mit dem kleinen Fanzine in 100er-Auflage. Alles verständlich und überaus sympathisch, gerade wenn man weiß, dass er sich selbst als Hobbymusiker sieht, der mit dem Drumherum nicht noch mehr Zeit verlieren will, die er der Musik widmen könnte.
Albini gilt als Hardcore-Indie-Veteran der alten Schule, lässt kein gutes Wort an Majorplattenfirmen und findet im Umkehrschluss nur gute für seine kleine Indiewelt – ohne dabei aber Gefahr zu laufen, das Außen zu ignorieren, sich dazu zu positionieren.
- Steve Albini
- Todd Trainer
- Bob Weston
Genau jene Indiewelt hat uns auch nach Chicago gelockt. Das dort ansässige Touch-And-Go-Label, mit dem Albini als Musiker und Produzent eng verbändelt ist, feierte im September 2006 mit einem dreitägigen Festival sein 25-jähriges Jubiläum. Unter anderem kamen Girls Against Boys, Negative Approach, Pegboy, Killdozer, Scratch Acid, Seam und auch Albinis Formation Big Black für One-off-Gigs wieder zusammen. Und jeden Tag circa 6.000 Besucher aus aller Welt, im Bewusstsein, dass hier – ja, sagen wir es so pathetisch – Geschichte geschrieben wird. Oder besser fortgeschrieben.
Angefangen hat diese 1980, als Corey Rusk und Tesco Vee beschlossen, aus dem von Vee und Dave Stimson betriebenen Fanzine Touch And Go auch ein Label zu machen. Rusk war damals selbst noch als Sänger bei der Harcore-Punk-Band Necros aktiv. Recht bald sollte er, dem Engagement für das Label geschuldet, dem aktiven Musikerleben goodbye sagen – einen Weg, den Vee so nicht gehen wollte, weshalb er lieber aus dem Label ausstieg, ihm aber mit seiner Band The Meatmen erhalten blieb. In den frühen 80ern erschienen auf Touch And Go im Folgenden stilprägende Alben von Bands wie Die Kreuzen, Negative Approach, Scratch Acid, Butthole Surfers und Big Black.
Ähnlich wie beim befreundeten Washingtoner Dischord-Label legte man von Anfang an sehr großen Wert auf die soziale Komponente, verstand sich als einen Bund von Freunden, die an einem alternativen Gesellschaftsentwurf arbeiten. Eine soziale Vision, auf die sich Steve Albini, von frühen Schultagen an immer ein Outsider, gerne einließ. Über die Jahre sollte er neben Rusk zur zentralen Person und zum Hausproduzenten der meisten Touch-And-Go-Bands werden. Das Label öffnete sich währenddessen und stellte den frühen Hardcore- und Punkbands bald Indie- und Folkacts zur Seite; später gründete man mit Quarterstick ein Sublabel für experimentellere Bandprojekte wie die Rachels oder June Of 44. Einziger schwarzer Fleck in der ansonsten blütenweißen Indiedreamstory war die sogenannte Butthole-Surfers-Affäre. Bis zum Rechtsstreit 1995 mit der Band, die ihren Aufstieg durchaus dem Label zu verdanken hatte, arbeitete man bei Touch And Go ohne Verträge. Das ökonomische Leitprinzip war simpel und fair: Nach Abzug der Produktions- und Promotionkosten wurde der Gewinn 50/50 geteilt. Als sich die Butthole Surfers wegen gefühlter Benachteiligung aus diesem Modell herausklagen konnten und ihre Rechte (trotz der US-amerikanischen Copyright-Gesetzgebung, die auch ohne Verträge für 35 Jahre die Rechte beim Label sieht) zurückbekamen, musste man reagieren. Damit aber auch genug der Geschichtsstunde. Willkommen zurück in der Gegenwart des Jahres 2006.
Sunday, bloody Sunday
Es durfte mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Gut, Steve Albini gilt als großer Koch – deswegen ja auch die Idee, ihn so zum Interview zu ködern. Zugleich aber eilt ihm der für uns Vegetarier nicht ganz so angenehme Ruf voraus, Fleisch richtiggehend zu vergöttern. Passend dazu erzählte er am Vorabend unseres Treffens auf der Bühne, wie gut Pferdefleisch schmecke. Das Interessante dabei: Das kann man nicht einfach nur als das Pro-Statement eines radikalen Fleischfans lesen, diese Aussage muss auf mehreren Ebenen verstanden werden: zum einen natürlich als kokettierend-provozierende Nummer, da er nach all den Jahren sein Indie-Klientel kennt, aber auch als realpolitisches Statement gegen die in Amerika derzeit grassierende Tendenz, nach nationalen und religiösen Stigmata auch kulturelle (wie hier durch Ernährungsweisen) aufzubauen.
 „Man isst für sich selbst“, heißt das dann im O-Ton aus dem Mund von Albini. „Wenn du nichts anderes als Marshmellows und Bananen essen willst, dann mach es. Ein Aphorismus sagt, dass du entweder isst, um zu leben, oder lebst, um zu essen. Manche Leute können aus dem Essen keinen besonderen Genuss ableiten, für andere wiederum ist es das Größte überhaupt. Es gibt keinen universellen Standard dafür. Es gibt momentan Ambitionen in den USA, gewisse Nahrungsmittel als illegal einzustufen, da sie zu abstoßend sind. Beispielsweise ist Pferdefleisch jetzt illegal. Mir erscheint es als krank, dass generell Standards aufgestellt werden, was man essen darf und was nicht, wo dies doch eine individuelle Entscheidung ist. So werden Kategorien geschaffen. Eine Person wird schlecht, da sie ein bestimmtes Nahrungsmittel isst. Das ist doch das Gleiche wie mit religiösen und kulturellen Zuschreibungen. In jüdischen und islamischen Kulturkreisen gelten gewisse Nahrungsmittel als unsauber. Leute, die diese essen, gelten als schlechtere Menschen. So ergeht es oft auch Veganern und Vegetariern. Andere nehmen sich heraus, zu denken, dass die politische Meinung von Veganern für sie unwichtig sei, nur da sie sich anders ernähren. Man wird wegen seiner Ernährung von gewissen gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen. Das erscheint mir doch fundamental falsch. Wenn man im Leben nicht unterscheiden kann zwischen den wirklich wichtigen und den unwichtigen Dingen, wenn also alles eine absolute Bedeutung hat, sind deine Entscheidungen automatisch gefährlich. Niemand sollte sich wegen dem, was er isst, schlecht fühlen müssen. Egal, ob es Junkfood ist oder gutes Essen. Was man isst, ist genauso eine persönliche Entscheidung, wie in wen man sich verliebt. Es mag einem etwas über die Persönlichkeit sagen, es definiert sie aber nicht.“
„Man isst für sich selbst“, heißt das dann im O-Ton aus dem Mund von Albini. „Wenn du nichts anderes als Marshmellows und Bananen essen willst, dann mach es. Ein Aphorismus sagt, dass du entweder isst, um zu leben, oder lebst, um zu essen. Manche Leute können aus dem Essen keinen besonderen Genuss ableiten, für andere wiederum ist es das Größte überhaupt. Es gibt keinen universellen Standard dafür. Es gibt momentan Ambitionen in den USA, gewisse Nahrungsmittel als illegal einzustufen, da sie zu abstoßend sind. Beispielsweise ist Pferdefleisch jetzt illegal. Mir erscheint es als krank, dass generell Standards aufgestellt werden, was man essen darf und was nicht, wo dies doch eine individuelle Entscheidung ist. So werden Kategorien geschaffen. Eine Person wird schlecht, da sie ein bestimmtes Nahrungsmittel isst. Das ist doch das Gleiche wie mit religiösen und kulturellen Zuschreibungen. In jüdischen und islamischen Kulturkreisen gelten gewisse Nahrungsmittel als unsauber. Leute, die diese essen, gelten als schlechtere Menschen. So ergeht es oft auch Veganern und Vegetariern. Andere nehmen sich heraus, zu denken, dass die politische Meinung von Veganern für sie unwichtig sei, nur da sie sich anders ernähren. Man wird wegen seiner Ernährung von gewissen gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen. Das erscheint mir doch fundamental falsch. Wenn man im Leben nicht unterscheiden kann zwischen den wirklich wichtigen und den unwichtigen Dingen, wenn also alles eine absolute Bedeutung hat, sind deine Entscheidungen automatisch gefährlich. Niemand sollte sich wegen dem, was er isst, schlecht fühlen müssen. Egal, ob es Junkfood ist oder gutes Essen. Was man isst, ist genauso eine persönliche Entscheidung, wie in wen man sich verliebt. Es mag einem etwas über die Persönlichkeit sagen, es definiert sie aber nicht.“
Wir hatten mit Albini am Vorabend vereinbart, die genaue Uhrzeit unserer Zusammenkunft durch einen morgendlichen Anruf zu arrangieren. Im gegenseitigen Einwerfen von Auftrittszeiten von Bands, die man unbedingt noch sehen wolle (schließlich dauerte das Festival noch an), einigten wir uns schließlich auf sieben Uhr abends – im Anschluss an das Konzert von Brick Layer Cake, dem Seitenprojekt des Shellac-Schlagzeugers Todd Trainer. Ganz die guten Gäste, die wir sein wollten, boten wir beim Telefonat an, den Einkauf zu machen – eine Offerte, die Albini gern annahm, auch wenn die gewünschten Zutaten nicht gerade üppig ausfielen: „Bringt doch bitte einen Apfel und eine Zwiebel mit.“ Wie bitte? Grund, skeptisch zu werden. Es lag etwas in der Luft, aber noch kein leckerer Duft, sondern unsere Angst, von Albini verarscht zu werden.
Cook you like a Hurricane
Die Befürchtung, dass dieser große Mann des Indie doch keine Lust auf ein Treffen haben könnte, wird bei seiner Ankunft im ehrwürdigen Electrical Audio Studio weiter genährt: Albini, der erst kurz nach uns eintrifft, kommt reingerauscht und ist mit dem „Hallo“ schon mitten in der Zubereitung. Dass der Mann sehr beschäftigt ist und dementsprechend alles straight durchzieht, war uns klar, aber, hey, gegen Abend und nach so einem kräftezehrenden Festival kann man es doch mal ruhiger angehen lassen. Mehr als um seine Gesundheit sind wir allerdings um unser Interview besorgt. Er wird das doch nicht falsch verstanden haben und die 20 Minuten, die er für die Zubereitung seiner Spaghetti mit Apfel-Zwiebel-Soße (immerhin, ein richtiges Gericht und nicht eine Kuriosität à la Zwiebelringe auf Apfelmus) einkalkuliert hat, als das ganze Treffen ansehen?
 Egal, wir lassen uns fallen in die Pfanne des Herrn. Also Albinis. Wie ein Wirbelwind agiert er um uns herum, rattert einen unendlichen Monolog über das Kochen herunter und fasst nebenbei noch das Festival zusammen: „Es war fantastisch. Jetzt nicht nur aus meiner individuellen Musikersicht heraus – ich genieße es ja immer, live zu spielen. Aber was ich als Zuschauer sehen durfte, waren gestern einfach die Auftritte meines Lebens. Unglaublich. So viele tolle Bands, vor allem jene, die sich extra wieder zusammengefunden haben. Sie waren alle so gut in Form. Ich war wirklich beeindruckt. Vor allem Scratch Acid, die waren fantastisch.“
Egal, wir lassen uns fallen in die Pfanne des Herrn. Also Albinis. Wie ein Wirbelwind agiert er um uns herum, rattert einen unendlichen Monolog über das Kochen herunter und fasst nebenbei noch das Festival zusammen: „Es war fantastisch. Jetzt nicht nur aus meiner individuellen Musikersicht heraus – ich genieße es ja immer, live zu spielen. Aber was ich als Zuschauer sehen durfte, waren gestern einfach die Auftritte meines Lebens. Unglaublich. So viele tolle Bands, vor allem jene, die sich extra wieder zusammengefunden haben. Sie waren alle so gut in Form. Ich war wirklich beeindruckt. Vor allem Scratch Acid, die waren fantastisch.“
Jede Bewegung sitzt: Zum Zwiebelschneiden schiebt er sich ein großes Messer zwischen die Zähne, um die Muskeln anzuspannen und damit die Augen nicht zum Tränen zu bringen. Das Würzen (er gibt neben den obligatorischen Salz und Pfeffer noch Senfkörner, Oregano, Peperoni, Zimt, Kapern und roten Pfeffer hinzu) erfolgt gestaffelt und mit detailliert vermitteltem Wissen über den jeweils richtigen Moment der Hinzugabe jedes einzelnen Gewürzes. Damit jedes ideal zur Geltung kommen kann – die Wasserbedürftigkeit von getrockneten Gewürzen sowie die Auswirkung von Salz auf die Wassertemperatur der Nudeln immer im Auge. Man kommt nicht umhin, dieses extrem straighte Agieren am Herd mit seiner Produktionsweise zu vergleichen: Schnell und mit geübten Bewegungen legt er alles an, mischt es direkt und ohne Schnörkel ab, lässt die einzelnen Zutaten für sich sprechen. Wir erfahren, dass er jeden Tag für seine Freundin und sich koche. Sie haben eine Abmachung: Er darf, so lange er will, im Studio arbeiten, wenn er danach für sie beide kocht.
Kaum hat er das erzählt, hört man auch schon einen Schlüssel in der Studiotür drehen. Seine Freundin kommt nach Hause und wird von Albini mit einem lauten „Hey, Sweety, mein Traum ist wahr geworden. Ich koche für Journalisten, anstatt ihre Fragen beantworten zu müssen“ begrüßt. Dann wird sie aber auch gleich beruhigt, dass er selbstverständlich nicht mit uns essen werde, sondern später noch mal für sie und sich koche. Sie schaut zufrieden drein und geht in die ins Studio integrierte Wohnung der beiden. Ja, richtig gelesen, der als Workaholic bekannte Albini wohnt tatsächlich in seinem Studio. Wie so viele andere im Indiemilieu Aktive trennt er nicht wirklich zwischen Arbeits- und Privatleben. Und so wird im Electrical Audio Studio alles gleich doppelt genutzt: der Aufenthaltsraum mit Carambolage-Billardtisch zum Beispiel – mehr als ein Symbol für Albinis Spielleidenschaft, die neben eben Billard (vgl. Shellacs „Billiard Player Song“) auch Poker umfasst. Von beidem sammelt er Videos und sogar TV-Mitschnitte wichtiger Partien.
Als ob er eine Trennlinie ziehen wollte, da es ihm dann doch zu privat wird, schreckt uns Albini mit einer immensen Stichflamme auf. Was passiert war? Nun, er hatte lediglich die schön braun gebrannte Melange aus Zwiebeln, Butter und Äpfeln mit einem halben Liter Weißwein gelöscht. Für ihn ein alltägliches Szenario. Für uns ein satter Schock. Und während wir deswegen noch zittern und unsere Fotoapparate checken, schmeißt er die Nudeln zur Soße in die Pfanne und setzt zum Abschluss des Monologs ein: „Und zuletzt der trockene Parmesan. Das ist wirklich wichtig. Viele denken, das sei ein Bonus. Ich sage: Der Käse ist das, was du wirklich isst. Die Pasta ist nur das Vehikel für den Parmesan. Noch etwas Salz, ein bisschen roten, nicht zu klein gehackten Pfeffer. Denn: Wer jetzt auf den Pfeffer beißt, kann selbst entscheiden, ob er ihn an die Seite des Tellers zurücklegt oder ob er ein bisschen Aufregung im Leben haben will. Und: Bon appetit! Ihr müsst euch merken: Ich weiß, wie man Platten macht – und ich weiß, wie man Pasta kocht.“
Wer will da schon „Nein“ sagen. Zumal wir, angefixt vom Zusehen bei der Zubereitung, sowieso schon am – ähm, es sei uns verziehen – Sabbern sind. Gehen wir also hinüber ins Wohnzimmer, zum Essen und Reden, denn entgegen unseren Befürchtungen hat sich Albini tatsächlich den ganzen Abend für uns geblockt oder zumindest so lange, bis er selbst und seine Freundin Hunger bekommen.
Kochst du denn auch mit den Bands, wenn sie für Aufnahmen bei dir sind?
Normalerweise nicht. Nur für Heather und mich. Aber manchmal esse ich schon mit der Band, da es einfach nett ist, eine informelle Situation, bei der man über alles reden kann.
Hat dich denn noch nie eine Band zu überreden versucht, dann zumindest mittags für sie zu kochen?
Für mich ist Kochen wie die Sache mit der Band. Es macht mir Spaß. Und am meisten Spaß macht es mir, wenn ich mit meiner Freundin koche. Wenn ich für andere Leute koche, ist das auch cool, aber nicht das Gleiche.
Würdest du unterschreiben, dass du Probleme mit dem Interviewgeben hast?
Nein. Die Basistätigkeiten, wenn man in einer Band ist, sind nun mal das Songschreiben, Shows-Spielen, Plattenaufnehmen und Mit-den-anderen-gut-Auskommen. Dann kommt eine Menge zweitrangiges Zeugs wie Fotoshootings, Interviews-Geben und Mit-Clubbesitzern-über-die-Auftritte-Verhandeln. Für uns ist die Band kein Job, sondern ein Hobby. Es ist wie Tennisspielen, Golfen oder Fischen. Das Aufnehmen von Bands [Albini ist es äußerst wichtig, nicht „Produzent“ genannt zu werden] ist mein Job. Und es ist ein großartiger Job. Aber manchmal hasse ich ihn. Meine Band aber hasse ich nie. Würde sich meine Band zu einem Beruf wandeln, dann würde ich sie auch hassen. Insofern wäre es grausam, mir selbst das anzutun. Es wäre, als ob ich mich selbst schlage. Ich bevorzuge es, die Band auf einem informellen Level zu halten.
Ganz anderes Thema: Hörst du dir eigentlich Technomusik an?
Nein. Also, klar, ich höre es, wenn jemand anderes sie spielt, aber ich höre nicht explizit hin.
Die Ästhetik von Minimal-Techno liegt ja nicht so weit weg von der von Shellac.
Einige der Glitch-Sounds, die ich gehört habe, sagten mir zu. Mir sagt an elektronischer Musik aber nicht zu, dass sie aus der Disco- und Club-Kultur herausgewachsen ist, dass sie Drogenmusik und dass sie die dilettantische Musik der Ober- und Mittelklasse ist. Das ist keine Musik, die ich oder meine Freunde je machen würden. Ich möchte mit dieser verwerflichen Kultur nichts zu tun haben. Die Sounds und Melodien mögen nett sein, aber es hat etwas von dem Gefühl, die Musik des italienischen Faschismus zu hören. Nicht dass Techno böse wäre, aber irgendwie leer, bedeutungslos. Außerdem hat Techno den Sound vom Prozess des Machens abgelöst.
Ich mag die Sachen von Kraftwerk, Suicide, Silver Apples oder DAF, also elektronische Musik, die sich nach einer neuen Erfahrung für mich anfühlt, bei der man den Prozess des Machens hören kann. Man hört, was sie spielen. Der Großteil der elektronischen Musik heute greift auf bereits existierende Sounds zurück. Das erscheint mir als ein kreativer Offenbarungseid. Aber klar, wenn du Tanzmusik hören willst, dann hat elektronische Musik ihre Berechtigung. Wenn nicht, dann ist diese Musik für sich selbst gesehen einfach nur schwach.
Nun ja, das ist schon eine sehr eingeengte Sicht der Dinge. Erstens gibt es auch unter den elektronischen Musikern viele Leute, die ihre Sounds selbst einspielen, zweitens hat beispielsweise Matthew Herbert den Sample-Diskurs initiiert. Es wird über dieses Problemfeld also sehr wohl auch Milieu-intern diskutiert. Und drittens sind in Europa, scheinbar im Unterschied zu Amerika, das Indie- und das Elektronik-Milieu nicht so getrennt, sondern eng miteinander verflochten.
Nun: Auf der einen Seite stehen doch die Musiker aus dem elektronischen Milieu, die sagen: „Das ist meine Musik, du kannst sie dir anhören.“ Auf der anderen Seite steht die auf Kollaboration angelegte Bandidee. Diese Idee der Zusammenarbeit ist den meisten elektronischen Musikern doch spinnefeind. Der Großteil elektronischer Musik wird von einem Typen in seinem Apartment mit Kopfhörern gemacht und später mit einem Laptop auf der Bühne aufgeführt. Vielleicht reagiere ich so vehement, da ich starke Egos einfach nicht mag. Ich schätze die Bandtradition des gemeinsamen Erarbeitens von Musik. Und wenn sie gut ist, dann kann man sagen: „Das haben wir zusammen geschaffen.“
Aber was ist in dieser doch sehr traditionellen Sicht der Dinge mit einem anderen traditionellen Musikgenre, das wenig bis gar nicht kollektiv angelegt ist und auch egozentrisch funktioniert – den Singer/Songwritern?
Manchmal mag ich auch sie nicht. Aber was ich an ihnen schätze, ist, dass es so ehrlich rüberkommt, wenn jemand allein seine eigene Musik spielt: „Ich habe bewusst eine limitierte Palette für meine Musik ausgesucht, nur meine Gitarre und meine Stimme.“ Das klingt für mich bescheiden: „Ich brauche nicht den Klang des Regenwaldes, ein Orchester, zerschlagenes Glas, Autohupen oder Elektrizität – es geht nur um meine Gitarre und mich.“ Ich höre seit 35 Jahren Musik. Manche erscheint mir genial, andere, hmm, falsch. Falsch im Sinne von artifiziell, prätentiös, dass sie nur für ihr Image gemocht werden will und nicht für ihr wirkliches Wesen.
Damit sind wir ja auch schon ganz nah dran an einem deiner Hauptthemen: dem richtigen Kontext. Du bist ja bekannt dafür, dass du nach wie vor nichts mit Majorlabels zu tun haben willst.
Yeah. Es mag sein, dass ich in der Zukunft irgendwann bemerken werde, dass das, was ich mag, nicht mit so theoretischen Gesichtspunkten außen herum zu tun hat, aber für den Moment macht das alles für mich Sinn.
Immer, wenn man ein Album hört, das du aufgenommen hast, dann kann man das sofort erkennen. Ab der ersten Bassdrum oder Snare. Der Mix ist sehr rau, man kann hören, dass du dich zurücknimmst, eher im Hintergrund stehst.
Ich möchte nicht abwerten, was ihr hört, aber ich denke, dass die meisten Bands, mit denen ich arbeite, mit sich selbst sehr zufrieden sind. Und eine selbstbewusste Band sagt „Ja“ zu ihrem Sound, zu ihrer Art zu spielen, sie braucht mich nicht, um sich neu zu justieren. Mein Job ist es, den Bands zu ermöglichen, das zu tun, was sie machen wollen, und dabei keine Fehler in der Übersetzung für ihr Publikum zu machen. So einfach ist das. Also: Die Einfachheit und Direktheit, die ihr hört, hat die Band bereits mitgebracht. Die Bands, die zu mir kommen, wollen generell eine sehr natürliche Präsentation. Ich will damit nicht sagen, dass die Idee, dass ich eine eigene Soundhandschrift habe, mir nichts bedeutet. Ich höre das oft, da muss also irgendwie auch was dran sein. Aber wenn ich mir Alben anhöre, die ich gemacht habe, Alben von Low, Shannon Wright, Will Oldham oder The Magnolia Electric Company beispielsweise, wenn ich mir diese eher weich klingenden Alben anhöre und sie mit beispielsweise Neurosis, The Jesus Lizard und White House vergleiche, dann höre ich keine Gemeinsamkeiten. Die bloße Qualität des Bandsounds und die Personalien der Bands dominieren doch über alle technischen Aspekte. Sie sind so unterschiedlich, dass das Gemeinsame im Vergleich doch eher gering ist.
Hast du eigentlich einen großen Bruch bemerkt, nachdem du Nirvanas letztes Album „In Utero“ aufgenommen hattest? Damit dürften ja ganz viele Leute auf dich gestoßen sein, die dich vorher nicht gekannt haben.
Ganz ehrlich: Das Nirvana-Album war für mich eine ganz normale Erfahrung. Wir haben ja in weniger als zwei Wochen aufgenommen. Sie waren sehr gut vorbereitet, verhielten sich wie jede andere kleine Indie-Band, mit der ich sonst zusammenarbeite. Sie kamen, sie spielten, wir mischten ab – und sie gingen wieder glücklich nach Hause. Es hingen keineswegs andere Leute mit ab, es gab keine Session-Musiker, wir mussten uns keine Freigaben einholen. Alles war also sehr normal. Ich habe es genossen, mit ihnen zu arbeiten. Ich war zuvor kein Fan, wurde aber während der Aufnahmen bis zu einem gewissen Grad zu einem. Ich entwickelte Respekt für Kurt Cobains Ideen als Musiker und für die Band als funktionierende Einheit.
Findet denn auch das Gegenteil statt? Merkst du manchmal während der Zusammenarbeit mit einer Band, dass du mit der Richtung, die sie einschlägt, nichts anfangen kannst?
Nun, es gibt sicherlich Momente, wenn jemand aus der Band sich unwohl fühlt mit dem, was im Studio gerade passiert. Das sind Momente, die ich nicht schätze. Ich bemühe mich wirklich sehr, Situationen zu vermeiden, die für mich persönlich ungemütlich werden. Der Sound, der aus den Boxen kommt, bedeutet nichts, wenn nicht alle, die an dem Prozess beteiligt sind, das Gefühl haben, dass sie zu ihrem Recht kamen.
Es gibt Leute, die sagen, dass nur das, was aus den Boxen kommt, der Sound ist. Für mich steckt viel mehr hinter dem Sound. Ich höre auch die Entscheidungen, die die Band auf dem Weg getroffen hat. Er erzählt mir etwas über die Leute, die diesen Sound machen. Klar, ich kann mir Musik professionell anhören, dann krieg ich nur den Sound mit, aber als Fan höre ich eben auch das, was hinter dem Sound steckt. Wenn ich die Ramones höre, höre ich mehr als nur den Sound. Es sind ja nur drei Elemente in ihrer Musik: Bass, Gitarre und Schlagzeug, alles ist sehr simpel, man könnte einen Computer programmieren, der eine ziemlich gute Simulation der Ramones hinbekommen würde, aber wenn du dir die echten Ramones anhörst, dann klingt das so, als ob es von niemand anderem als ihnen gemacht sein könnte. Selbst wenn andere Leute genau das Gleiche spielen, klingt es nicht nach ihnen.
Ich maße mir ja nicht an, grundsätzlich zu wissen, was das Beste für eine Band ist, immerhin kenne ich nicht ihre Geschichte und ihre Beziehungen, also überlass ich es ihnen auch gerne selbst, ihre Probleme zu lösen. Ich hoffe immer, dass der Sound, den ich aufnehme, diese Beziehungen einfängt.

This is where the Magic happens
Sound? Ein gutes Stichwort. Immerhin findet unser Interview im Vorraum von Albinis legendärem Studio Electrical Audio, das seit den 90ern durch zahlreiche hier aufgenommene Alben Weltruf erlangte, statt. Wir bitten den Mann in einer Gesprächspause also um Zutritt zu dem Reich, für das sich nur zwei Tage nach unserem Gespräch The Breeders für die Aufnahmen ihres kommenden Albums angekündigt haben. Kein Problem, so Albini, aber er könne uns nur das kleinere Studio B zeigen – im großen sei gerade eine Band zugange. Wir durchschreiten also einen kurzen Gang und landen schon wenige Meter hinter dem Billard-Tisch im Control-Room des kleineren Studios, in dem sich eine aufgeräumt wirkende schlichte Ansammlung analoger High-End-Technik befindet. Interessanter ist da schon der eigentliche Aufnahmeraum, auf den man durch eine Scheibe hinunterblickt. Ein ungefähr zehn Meter hohes, von Backstein umgebenes Loch mit circa sechs mal sechs Metern Grundfläche – wie gesagt: rundherum komplett aus Stein. Wer sich jemals über den omnipräsenten Raumklang einer von Albini aufgenommenen Platten gewundert haben sollte – hier hat er seine Ursache.
Wir gehen zurück in den Aufenthaltsraum. Es ist noch immer der 10. September 2006. Eine Frage können wir uns nicht verkneifen, die man als Profi eigentlich erst am Ende eines Interviews stellen sollte, was wir auch besser mal getan hätten. Warum? Nun, ein Interview mit Steve Albini zu bekommen ist eine Sache. Ihm dabei für Minuten die Tränen in die Augen zu treiben ist hingegen etwas, auf das wir gerne verzichtet hätten.
Morgen vor fünf Jahren, am 11. September 2001, waren wir beim Shellac-Konzert in Berlin. Was ich mich seitdem frage: Habt ihr damals lange diskutiert, ob ihr überhaupt spielen sollt?
Oh ja, das haben wir. Wir haben im Fernsehen gesehen, wie das zweite Flugzeug ins World Trade Center einschlug. An dem Punkt wurde uns klar, dass es sich hier um eine ernste Sache handelte. Wir waren sehr niedergeschlagen. Wir waren danach zwei Wochen in Berlin gestrandet und konnten aufgrund der Umstände nicht zurück. Wir redeten an diesem Tag lange darüber, uns ging es beschissen, aber wir merkten, dass es uns nicht besser gehen würde, wenn wir nicht spielen. Und dass wir für die Zeit, die wir auftreten, vielleicht über alles andere auch nicht nachdenken müssen. Das war für mich möglicherweise das einzige Mal, dass Musik tatsächlich auch eine Fluchtmöglichkeit darstellte. Eines möchte ich übrigens in dem Zusammenhang loswerden: Die Menschen, die wir in Deutschland trafen, waren so nett und so gastfreundlich zu uns. Die Leute im Hotel sagten: „Ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt, auch wenn ihr kein Geld mehr haben solltet.“ In der Maria am Ostbahnhof hieß es von Veranstalterseite an dem Abend, an dem wir spielen sollten: „Passt mal auf, wir können verstehen, wenn ihr in dieser Situation nicht spielen wollt. Die Gage bekommt ihr von uns in jedem Fall, und wenn ihr eine Unterkunft braucht oder jemanden zum Reden wollt – wir sind für euch da.“ Am nächsten Tag gab es dann eine öffentliche Schweigeminute. Ich wusste davon gar nichts, aber als ich vom Hotel zum Bahnhof lief, um mir eine Zeitung zu kaufen, standen plötzlich alle still, und niemand redete ein Wort. Mir wurde dabei bewusst, dass sie das in gewisser Hinsicht für mich taten, und das hat mich wahnsinnig bewegt. Es herrschte nach dem 11. September weltweit der Geist der Solidarität, trotz aller politischen Unterschiede. Als dann klar wurde, dass unser Präsident diese fruchtbare Stimmung mit Füßen trat, indem er klarmachte: „Mir ist das alles scheißegal, ich mache jetzt, was ich für richtig halte“, schämte ich mich so maßlos dafür. Und ich tue es bis heute. Das ist, als würde man zu einer Beerdigung gehen, um seine Anteilnahme auszudrücken, und jemand gibt dir plötzlich eine Ohrfeige und brüllt dich an, dass du das Maul halten sollst. Diese Form der Beleidigung ist unverzeihlich.
Es ist schwer, jetzt wieder zu Banalem zurückzukehren, aber … Die paar Songs, die Big Black spielten, waren die ein Geschenk für Corey Rusk?
Ja, ein freiwilliges Geschenk. Er erwähnte, dass er Scratch Acid zu einer Show bewegen konnte, da schlug meine Freundin vor, wir sollten doch auch spielen. Sie sagte, ich solle Jeff und Santiago anrufen und das klären, und ich sagte: „Ich weiß gar nicht, ob Corey das will.“ „Na klar will er das“, erwiderte sie. Ich rief Corey an, und er meinte nur: „Wow, das wäre toll!“
Musstet ihr nach all den Jahren viel proben?
Nein, ein paarmal. Shellac waren viel auf Tour, also hatten wir kaum Zeit. Wir probten also nur wenig, und es war auch nicht ganz leicht. Wisst ihr, das war eine Geste, das war mir das Wichtigste daran.
 Du erwähntest, dass Shellac ein reines Hobby für dich sei. Passiert es dir häufig, dass du Bands begegnest, die das ähnlich sehen? Können die, die bei Touch And Go arbeiten, davon leben?
Du erwähntest, dass Shellac ein reines Hobby für dich sei. Passiert es dir häufig, dass du Bands begegnest, die das ähnlich sehen? Können die, die bei Touch And Go arbeiten, davon leben?
In den USA ist es fast ausgeschlossen, von der Musik zu leben. Es gibt keinerlei Zusatzunterstützung wie in Kanada, Frankreich oder sogar England. Hier Musiker zu sein heißt normalerweise, Amateur zu sein. Es gibt eine kleine Gruppe von Musikern, die sagen können: „Ich bin professioneller Musiker.“ Aber selbst die müssen noch irgendwo jobben, können in diesem Job aber auch keine Karriere machen, denn der Arbeit können sie nur zwischen den Tourneen nachgehen. Es ist sehr ungewöhnlich hier bei uns, dass jemand sagen kann: „Meine Band ist mein einziges Einkommen.“ Es passiert – aber nur sehr selten.
Daher rührt ja auch häufig die Tatsache, dass viele Bands, obwohl sie lange dagegen wetterten, irgendwann doch einen Major-Vertrag unterschreiben, weil sie aus den Zwängen heraus nicht die Zeit haben, ihre Band selbst so zu promoten, um davon leben zu können. Sie verfallen dann doch dem Traum, dass sie groß werden könnten, obwohl viele von ihnen wissen, dass das fast unmöglich ist.
Es gibt zwei parallele Musikwelten. Die professionelle, wo jeder seinen eigenen Jet, Welt-Tourneen, Videos und Roadies bekommt und in schicken Hotels wohnt. Diese Superstar-Welt gibt es nicht für Indie-Bands. Die Parallel-Welt ist der Underground, wo ich mich genauso bewege wie alle meine Freunde. Wir sind nicht notwendigerweise professionelle Musiker. Aber wir sind begeisterte Musiker. Wenn du also die Video-, Flugzeug-, etc.-Welt willst, gibt es die nur über einen Major. Und wenn du dich gut machst in dieser Superstar-Welt, dann hast du das auch für ein Jahr oder so. Bis dein Label wahrscheinlich entscheidet, dass du nicht mehr erfolgreich genug bist, und deine Band zerstört. Oder du bist plötzlich in dieser Welt gefangen, die dir nicht mehr erlaubt, in den Underground zurückzukehren, weil du rechtliche Verpflichtungen gegenüber der Showbusiness-Welt hast, die das verhindern. Für die nächsten zehn Jahre bist du dann beispielsweise gebunden an jenen Manager oder jene Plattenfirma. Fazit: Wenn du dich mit einem Leben unterhalb der Superstar-Träume abfinden kannst, bist du heute in der Underground-Welt besser aufgehoben als jemals zuvor, schätze ich. Du kannst mit diesen geringeren Ansprüchen ewig weitermachen.
Man bekommt ja durch zahlreiche aktuelle Beispiele tatsächlich das Gefühl vermittelt, dass die Major-Welt unattraktiver geworden ist als jemals zuvor.
Ja, vieles ist schlechter geworden. Vieles hat sich grundlegend gewandelt in den letzten Jahren, angefangen natürlich bei der elektronischen Übertragung von Musik. Vieles ist dadurch schlechter geworden, aber eine sehr gute Sache hat sich zum Positiven geändert: das Machtverhältnis. Die Independent-Labels verfügen mittlerweile über die gleichen Tools, mit denen man potenziell einen Superstar aufbauen könnte, wie die Majors.
 Du meinst wegen des Internets?
Du meinst wegen des Internets?
Teilweise deswegen, teils auch, weil das Netzwerk der Indie-Leute viel Zeit hatte, sich zu entwickeln. Früher gab es vielleicht in einer bestimmten Ecke des Landes nur zwei oder drei Clubs, wo deine Band spielen konnte. Heute sind das oft 20. Das Internet als Verkaufs- oder Promotionplattform macht den großen Unterschied zu früher. Wenn man in den 70er- oder 80er-Jahren ein lokal anerkannter Musiker war, kamen vielleicht 300 bis 400 Leute zu deiner Show. Das heißt aber noch lange nicht, dass dich damals irgendwer in der Nachbarstadt kennen musste. Dann kam die erste wichtige Entwicklung: Mit dem Aufbau von Independent-Vertrieben war es plötzlich möglich, 300 bis 400 Besucher in verschiedenen Städten des Landes zu deinen Konzerten zu kriegen. Aber im Ausland aufzutreten war immer noch fast unmöglich. Man musste physische Tonträger in fremde Länder verschiffen, in der Hoffnung, dass sie da irgendwer kaufen würde. Mit der Verbreitung des Internets stieg auch die Chance, dass sich eine solche Nachfrage von selbst erzeugte. Heute hast du so vielleicht immer noch nur 300 Leute zu Gast bei deinem Konzert in Chicago, dafür aber unter Umständen auch 300 in London, München oder Tokio. Man kann tatsächlich weltweit ein Publikum bekommen. So etwas hätte früher mit konventionellen Mitteln vielleicht zehn Jahre gedauert. Und das passiert heute, oder es passiert nicht – aber Geld und Energie, wie sie die Majors haben, braucht man dazu nicht mehr zwangsläufig.
Was ja wiederum Indie-Bands, die schon über solche Strukturen verfügen, für Majors heutzutage noch interessanter macht als früher. Das merkt man ja schon daran, dass Majors seit Jahren sehr viel massiver Indie-Bands signen. Bemerkst du dieses Phänomen eigentlich auch in deinem Umfeld, dass die Majors da anklopfen?
Ich glaube, die Idee, eine kleine Band zu nehmen und zu versuchen, sie in den Mainstream zu bringen, ist irgendwie tot. Heutzutage geht es stärker als früher von der Band selbst aus, bei wem sie unterzeichnet. In den 90ern, nach Nirvana vor allem, gab es eine Zeit, dass die Majors alles mit zwei Beinen signten … Eigentlich wie ein verzweifelter Mann, der abends ausgeht und sich sagt: „Wenn 0 Uhr durch ist, nehme ich alles mit nach Hause – Hauptsache, es hat Titten.“ Das passiert nicht mehr so oft. Manchmal hört man solche Geschichten noch, dass eine kleine Band eine große Firma überzeugen konnte, sie zu signen, und nach einer gewissen Zeit werden sie dann meistens gedroppt. Es passiert noch, aber nicht mehr so oft, natürlich auch, weil den großen Firmen das Geld fehlt. Aber Verkaufszahlen, na ja. Meine Lieblingsbands werden wahrscheinlich nicht allzu viele Platten verkauft haben. Deshalb interessiert mich das auch nicht – obwohl es natürlich schön für die Band ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass Verkaufszahlen irgendeine Rolle spielen, wenn ich mit einer Band arbeite.
In einer Bühnenansage gestern bei Big Black sagtest du, viele Leute sähen nur die Sex Pistols und als nächstes großes Ding Nirvana. Dass sie alles dazwischen übersehen.
In Mainstream-Fernsehsendungen oder -Zeitschriften gibt es häufig diese Tendenz. Dass zehn oder zwölf Jahre nichts passiert sei. Für mich sind die 80er-Jahre eine sehr aktive, aufregende Zeit. Aber wahrscheinlich ist das Problem, dass sie keine eindeutig herausragenden Charakteristika hervorgebracht haben. Gestern auf dem Festival waren zum Beispiel so unterschiedliche Bands wie Killdozer oder Scratch Acid, die wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Und vergleicht das erst mal mit einer Band wie The Ex. Es verbindet The Ex überhaupt nichts mit Negative Approach, außer dass man beim Hören dieser Band gleichermaßen erregt wird. Daher sind die 80er so schwer zu greifen, weil diese Bands stilistisch so wenig gemein haben, außer eine bestimmte Weltsicht. Und darüber lässt sich nur schwer reden und Verallgemeinerungen treffen.
 Es gibt eben nur den subkulturellen Kontext um diese Bands herum.
Es gibt eben nur den subkulturellen Kontext um diese Bands herum.
Ja, aber selbst auf politischer Ebene waren die 80er sehr komplex. In England gab es große anarchistische Bewegungen, die beispielsweise proklamierten: „Diese Gebäude sind dazu da, um von uns genutzt zu werden. Sie sind öffentlich, also gehören sie uns.“ Eine anarchistische, kommunistische Interpretation von Besitz. In den USA gab es wiederum die DIY-Bewegung, die sagte: „Ich brauche keine Regierung, die mir ein Haus baut – ich kann mir mein eigenes beschissenes Haus bauen!“ Das Beispiel zeigt: Sogar auf politischer Ebene gab es in den 80ern die unterschiedlichsten Positionen bei diesen Bands. Aber die gemeinsame Begeisterung für Musik sorgte dafür, dass diese Leute eine Verbindung spürten. Menschen, die wirklich gar nichts miteinander zu tun hatten, konnten sich auf dem Wege gegenseitig bewundern und sich unterstützen. Ich versuche gerade daran zu zeigen, warum die Musik der 60er-Jahre sich von Punk unterscheidet, warum aber eben auch die 80er sich weitgehend davon absetzten. Ich glaube, in den 60ern gab es einige Dinge mehr, die universell waren für die Musiker. Fast jeder war Drogenkonsument, in der Antikriegsbewegung und für freie Liebe, nahezu jeder hatte eine kommunistische Vorstellung von Besitz. Einige dieser Tendenzen überlebten Punk bis in die 80er-Jahre hinein. Aber über die 80er-Jahre lässt sich eben dennoch kein so großes, verallgemeinerndes Statement anführen. Daher ist meine Empfindung, warum die 80er so wichtig waren, dass die meisten Bands sehr unterschiedlich klangen, aber eben auch sehr unterschiedliche Positionen bezogen. Gleichzeitig gab es diesen massiv kameradschaftlichen oder gar freundschaftlichen Vibe. Und den gab es in diesem Maße in meinen Augen zu keiner anderen Zeit. Musikhistorisch herrscht keine große Anerkennung für die 80er; der häufige Glaube ist, dass das musikalisch keine sehr fruchtbare Zeit gewesen sei. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Bands aus den 60ern die Punk-Ära überlebt haben: Es fallen einem nicht sehr viele ein. Und wenn man sich anschaut, wie viele Punk-Bands der 70er die 80er oder gar die 90er überlebt haben – dann sind das auch nicht sehr viele. Aber sehr viele der 80er-Underground-Bands haben 20 Jahre oder mehr überdauert. Und das erscheint mir doch sehr auffällig.
Was hältst du denn generell von Reunions?
Für Fans ist das toll. Ich konnte mir dadurch endlich Television anschauen. Oder Wire. Ich war begeistert, als ich diese Möglichkeiten bekam. Ich denke, jede Band sollte selbst entscheiden dürfen, wann sie beginnen und wann sie aufhören will.
 Ja, klar, aber denkst du als Fan nicht auch manchmal: „Macht jetzt bitte keinen Fehler“, wenn sich eine für dich wichtige Band wieder zusammentut?
Ja, klar, aber denkst du als Fan nicht auch manchmal: „Macht jetzt bitte keinen Fehler“, wenn sich eine für dich wichtige Band wieder zusammentut?
Manchmal schämt man sich für eine Band, die wieder zusammen spielt. Man wünscht sich, das wäre nie passiert. Wenn sie sich wieder vereinigt und der Anlass vor allem kommerzieller Natur ist zum Beispiel. Ich kann nachvollziehen, dass man empfindet, das sei kein ausreichender Grund. Aber wenn ich eine Band hatte und wir beschließen eine Reunion, dann soll mich jeder am Arsch lecken, der mir das verbieten will. Keine Band, bei der ich jemals gespielt habe, hatte jemals den Wunsch, wieder anzufangen aus irgendeinem finanziellen Grund. Die Big-Black-Show gestern wird wahrscheinlich die einzige Reunion überhaupt gewesen sein. Mein Grund dafür war, Touch And Go ein kleines Dankeschön auszusprechen. Aber wenn ich den Wunsch gehabt hätte, das zu etwas Dauerhaftem werden zu lassen, und die anderen das auch gewollt hätten – fuck everyone who says we can’t.
Siehst du dir noch viele Bands live an?
Ja, wenn ich die Zeit habe.
Bist du also im Bilde, was in Chicago im Einzelnen passiert?
Nein, nicht wirklich. Ich sehe mir in erster Linie Bands an, aus denen ich jemanden kenne. Ich gehe nicht mehr allzu häufig zufällig zu einer neuen Band.
Erinnerst du dich eigentlich noch an dein erstes Treffen mit Corey?
Das erste Mal war nur ein kurzes Treffen. Wir waren beide Teil eines Panels bei einem Musik-Seminar. Da ging es um irgendwas mit jungen Leuten in der Musikszene. Zu der Zeit war ich 19, Corey 18, und Rick Rubin, der übrigens auch da war, war 19 oder 20. Seinen Bart hatte er da noch nicht. Danach spielte meine Band einige Shows, die Corey in Detroit organisiert hatte, und es entwickelte sich eine Freundschaft. Mit Touch And Go in Kontakt zu geraten war wirklich das Beste, was mir jemals in meiner ganzen Verwicklung mit Musik passiert ist.
Stimmt es eigentlich, dass sie grundsätzlich immer noch keine Verträge mit ihren Bands haben? Auch nach dem Rechtsstreit mit den Butthole Surfers nicht?
Ja. The Butthole Surfers sind übrigens ein Sonderfall. Die machen sich wirklich überall Feinde – egal, wohin sie kommen. Es gibt keinen auch nur theoretisch vorstellbaren Vertrag, der diese Band davon abhalten könnte, sich Feinde zu machen. Das sind die abgrundtief egoistischsten Menschen auf der ganzen Welt.
Trauen die sich denn auf ihren Tourneen noch nach Chicago?
Ich weiß nicht mal, ob es diese Band noch gibt. Weißt du, ihre Fans müssen sich nicht zwangsweise darum scheren, ob diese Band in geschäftlicher oder privater Hinsicht nur aus Arschlöchern besteht. Das sehen die Fans doch gar nicht. Erst wenn man sich mit der Musikszene tiefgründiger auseinandersetzt, fallen solche Dinge auf und scheinen wichtig zu werden. Ich persönlich glaube aber, dass man solche Sachen in manchen Fällen der Musik anhören kann. Ich kann beim Anhören bestimmter Platten das tiefe Bedürfnis empfinden, die entsprechenden Musiker niemals kennenlernen zu wollen.
Du hast ja Journalismus studiert. Hättest du dir zu einem bestimmten Zeitpunkt deines Lebens überhaupt vorstellen können, diesen Job zu machen, den wir beide hier gerade ausüben?
Ich hatte damals immer die Vorstellung, Zeitungsjournalist zu werden. Für eine kurze Zeit habe ich auch in einer Zeitung gearbeitet – als Pflicht-Teil meines Studiums. Das jeden Tag zu tun machte mir klar, dass ich gar keine Lust habe, das jeden Tag zu tun. Also wollte ich lieber nur noch als freier Journalist arbeiten oder ein Fanzine machen oder nur für mich schreiben. Aber ich wollte nicht mehr Teil der Machtstrukturen innerhalb einer Tageszeitung sein, die genauso hierarchisch funktioniert wie jeder andere größere Betrieb. Ich wollte nur noch darüber schreiben, was mich interessiert. Und das geht nur losgelöst von dieser Unternehmenskultur.
Schreibst du denn noch viel?
Nein, nur hin und wieder schreibe ich technische Aufsätze für Magazine, die sich mit Aufnahmetechnik befassen, oder irgendwas über Musik. Oder ich schreibe Kurzprosa, aber ausschließlich für mich selbst.
Hast du davon etwas veröffentlicht?
Ein paar Texte vor langer Zeit.
 Suchst du textlich einen bestimmten Zugang bei den Shellac-Lyrics?
Suchst du textlich einen bestimmten Zugang bei den Shellac-Lyrics?
Viele unserer Songs thematisieren etwas sehr Konkretes. Aber es gibt selten einen exakten Text, oft ändert er sich von Tag zu Tag. Vieles von dem, was ich auf der Bühne sage, ist spontan. Der Text ist nicht wie in Stein gemeißelt.
Einer meiner Lieblingsautoren ist übrigens Heinrich Böll. So, wie sich das zumindest im Englischen liest, gefällt es mir sprachlich sehr: kurze Sätze, einfache Sprache, oft der gesprochenen Sprache sehr ähnlich. Subjekt, Verb, Objekt. Und weil die Sprache so einfach gehalten ist, lassen sich seine Texte, glaube ich, auch so gut ins Englische übertragen. Alles, was er schreibt, entspricht exakt dem, was du wissen sollst. Da gibt es nichts Gekünsteltes an seiner Sprache. Er ist auch der einzige mir bekannte Autor, der sich konkret mit der direkten Nachkriegszeit in Deutschland auseinandergesetzt hat. Das wirkt ja fast wie ein Tabu in Deutschland, über diese Zeit zu reden. Wenn ich Böll lese, habe ich fast das Gefühl, als schäme sich Deutschland für diese Zeit, als alles am Boden war. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass Deutschland und Japan in ganz einmaligen historischen Situationen waren. Normalerweise, wenn jemand besiegt wird, wird auch die Kultur des Landes komplett zerstört. Und hier gab es jeweils die Situation, dass die Besiegten Unterstützung von außerhalb erhielten und ihrer Kultur damit erlaubt wurde, zu überleben. Das haben die Römer und Griechen einst nicht getan, nicht wahr? Ich bin sehr fasziniert von dieser Zeit des Aufbaus. Auch in Japan. Da gab es diesen Comic-Zeichner namens Osamu Tezuka, der vor fünf oder zehn Jahren starb. Er kreierte einen berühmten Cartoon-Character. Der heißt im Englischen Astro Boy, „Atom“ im Japanischen. Atom ist ein mechanischer Junge, der von einem Wissenschaftler als Metapher für den Neuaufbau in Japan nach dem Krieg hergestellt wurde. Er wird mit Atomenergie betrieben. Die Idee dahinter ist, dass Japan, statt von den USA durch die Atombombe zerstört worden zu sein, neu aufgebaut wird wie eine junge energetische Kraft mit einem Atomkern. Dieser Allegorie begegnet man sehr häufig in der japanischen Literatur und in Comics. Ich bin also sehr interessiert am Aufbau, auch in Deutschland, als man sich dort eine neue Identität schuf. Es war weit komplizierter, als das Land noch geteilt war, aber jetzt habt ihr eine einmalige Situation, wo versucht wird, die Leute aus dem Osten miteinzubeziehen, die ja so lange Jahre isoliert waren. Ich kann mir vorstellen, wie aufregend das für die Leute im Osten derzeit sein muss.
Ich denke, da interpretierst du die Situation etwas zu optimistisch. Es ist für viele Menschen gerade im Osten derzeit sehr deprimierend, weil sie ganz andere Hoffungen hatten, als die Mauer fiel. Nicht wenige Menschen im Westen denken sogar, man sollte sie wieder aufbauen.
Ja, aber sogar in Ostberlin gibt es Dinge wie die Volksbühne und den Ostbahnhof. Tolle Strukturen, tolle Orte. Früher waren das verbotene Orte.
Aber du redest ja nur von Berlin. In vielen anderen kleinen Städten im Osten sieht es wirklich runtergekommen aus, viele Menschen sind dort nicht glücklich. Man darf auch nicht vergessen, was für eine kurze Geschichte Deutschland hat – kurz, aber wahnsinnig bewegt. Die Deutschen setzen sich mit der Wende auseinander, gleichzeitig ist der Zweite Weltkrieg noch präsent. Das ist für viele Menschen nicht ganz leicht.
Da gibt es Parallelen zu den USA. Hier gab es zu Beginn einen großen revolutionären Geist. Innerhalb von 100 Jahren kam es zum Bruch zwischen dem Norden und Süden wegen der Sklaverei und schließlich zum Bürgerkrieg. Und diese Kluft gibt es heute noch zwischen der Land- und der Stadtbevölkerung. Texas, das ja eine Zeit lang zu Mexiko gehörte, ist der Inbegriff für diese regionale Zerfaserung, die man in den USA überall findet. Aber es gibt immer noch das vereinigende Element für alle noch so unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.
Wenn die Basken sich zum Beispiel damit anfreunden könnten, sich eher als Teil Europas zu begreifen als innerhalb ihres regionalen Identitätskonflikts, vielleicht könnten sich dann die Spannungen zwischen ihnen und Spanien abbauen. Genauso im Fall von West- und Ostdeutschland. Dort sollte man den lokalen Besonderheiten ihr Recht zusprechen, statt alles als Teil eines großen Ganzen sehen zu wollen. Grundsätzlich denke ich, es gibt Potenzial für Parallelen zwischen den USA und der EU. Wenn Europa sich zusammenraufen könnte, würde es eine riesige ökonomische Kraft darstellen. Das wäre fantastisch. Anstatt sich auf die USA oder China stützen zu müssen, könntet ihr wirtschaftliche Probleme selbst lösen.
Was anderes: Du hast ja den Ruf eines Workaholic. Wenn ich mich hier umsehe, sieht die Arbeitsatmosphäre aber sehr gemütlich aus. Sehr entspannt.
Wenn ich arbeite, versuche ich mich immer zu 100 Prozent auf die Aufgabe zu konzentrieren. Aber parallel dazu will ich auch mein Leben leben. Wenn ich also meine Freundin sehe, möchte ich auch da zu 100 Prozent anwesend sein. Also organisiere ich mir den Tag sehr genau, damit das alles hinhaut. Vor zehn Jahren gab es eine Zeit, da habe ich jeden Tag von zehn Uhr morgens bis drei Uhr nachts durchgearbeitet. Die ganze Zeit im Studio. Ich glaub, ich wurde da mit der Zeit ein bisschen verrückt. Also nehme ich mir heutzutage immer jeden Dienstag frei. Dienstag ist Poker-Nacht, also passt das sehr gut.
Spielst du Poker um Geld? Wenn ja, was war der höchste Gewinn und was der höchste Verlust?
Aber klar spiele ich um Geld. Das ist der einzige legitime Weg zu pokern. Der größte Verlust an einem Tag waren so 200 Dollar. Und ich habe einmal ein bisschen mehr als 2000 Dollar an einem Tag gewonnen. Das war ein wirklich guter Tag.
Gegen wen hast du das denn gewonnen?
Gegen irgendwen im Internet.

Wieder ein Sprung: Was hältst du denn im Nachhinein von dem Namen deiner alten Band Rapeman?
Ich denke, dass die Kontroverse um den Namen immer etwas überbetont wurde. Für meine Mutter ist der Name Rapeman nicht beleidigender als der Name Sex Pistols. Der Name stammte aus einem japanischen Comic über einen „professionellen“ Vergewaltiger, der Männer und Frauen zugleich vergewaltigte, so wie ein Auftragskiller Menschen tötet. Teilweise ging es da um eine Art Rache-Idee, außerdem um die Position des Characters, das aus einem Gefühl der Pflicht heraus zu tun, so nach dem Motto: „Das ist mein Job.“ Wir waren verwundert von der Tatsache, dass es möglich ist, dass ein solcher Comic Teil populärer Kultur sein kann. Aber der Name einer Punkband stellt für mich generell keinen großen Diskussionspunkt dar. Auch, weil jedem, der sich halbwegs mit der Band auseinandergesetzt hat, klar sein musste, dass wir dem Feminismus inhaltlich sehr nahestanden. Ich habe mich immer klar als Befürworter der Frauenbewegung gesehen.
Bist du denn großer Fan der japanischen Kultur?
Ja, für eine Weile war ich das. Ich habe im College ein bisschen japanische Literatur studiert und war eine Weile von Mangas fasziniert. Aber ich habe mich seit Jahren nicht mehr wirklich damit auseinandergesetzt. Es gibt einige Leute, die ich bemerkenswert finde, wie den japanischen Schriftsteller Shusaku Endo. Das Thema seines Schreibens ist sehr komplex: Bei ihm geht es textlich um die wörtliche Bedeutung, die implizite Bedeutung und eine Metaebene. Ich mag seine Texte wirklich sehr.
Danke für das Gespräch.
Und so entlässt uns Steve Albini aus seinem Reich in die laue Chicagoer Spätsommernacht. Und stellt sich sicherlich gleich danach mit seiner Freundin an den Herd, um erneut zu kochen. Wir sind ein wenig erschlagen und reden zunächst nicht viel. Erschlagen und irgendwie fast pathetisch aufgewühlt von den Ereignissen der letzten drei Stunden. Fühlt sich so ein journalistisches Berufshighlight an, das man jahrelang für unmöglich gehalten hatte, ja, das selbst nach der Zusage noch so seltsam irreal wirkte? Richtig, das tut es. Übrigens bis zum Schreiben dieser Zeilen.
Kochen wie Steve Albini:
 „Also: Wir benutzen einen Apfel, der zugleich süß und sauer ist, als Gemüse. Dazu schneiden wir ihn in große Stücke, sodass er gleichzeitig mit den Zwiebeln durch ist. Eine gute Lektion: Man kann praktisch alles in der Küche mit einem guten großen Messer machen. Als ich noch zum College ging, war die Frage immer nur, ob wir das Essen klauen oder kochen sollen. Ich fühlte mich immer wohler mit dem Kochen. Und wenn man erst mal ein paar Grundprinzipien gelernt hat, dann kann man fast alles selbst kochen. Ich koche jeden Tag. Meine Freundin und ich haben so eine Abmachung: Ich kann so lange arbeiten, wie ich will, wenn ich danach für uns koche.
„Also: Wir benutzen einen Apfel, der zugleich süß und sauer ist, als Gemüse. Dazu schneiden wir ihn in große Stücke, sodass er gleichzeitig mit den Zwiebeln durch ist. Eine gute Lektion: Man kann praktisch alles in der Küche mit einem guten großen Messer machen. Als ich noch zum College ging, war die Frage immer nur, ob wir das Essen klauen oder kochen sollen. Ich fühlte mich immer wohler mit dem Kochen. Und wenn man erst mal ein paar Grundprinzipien gelernt hat, dann kann man fast alles selbst kochen. Ich koche jeden Tag. Meine Freundin und ich haben so eine Abmachung: Ich kann so lange arbeiten, wie ich will, wenn ich danach für uns koche.
 Wenn ihr beim Zwiebelschälen nicht heulen wollt, dann steckt euch einfach ein Holzstück in den Mund. Oder eben wieder das Messer. So sind eure Muskeln beschäftigt, und ihr habt keine Zeit zum Heulen. So, die Äpfel und die Zwiebeln werden jetzt so lange gekocht, bis sie eine schöne Karamellfarbe haben. Dazu fängt man zunächst mit etwas Olivenöl an. Drei Suppenlöffel. Dann gebt ihr etwas Butter dazu, vielleicht halb so viel wie Öl. Parallel setzt ihr das Wasser auf. Sobald Zwiebel, Äpfel und Butter braun werden, kann man Salz dazugeben. Wenn man es zu früh macht, dann wird das ganze Wasser aus den Zutaten gezogen. Mit dem Salz ist es auch so eine Sache: Wenn man viel braucht, zum Beispiel für das Kochwasser für die Nudeln, dann sollte man billiges nehmen. Wenn es um den Geschmack geht, bevorzuge ich Meersalz. So, das Gemüse ist halb durch. Der ideale Zeitpunkt, um die Nudeln ins Wasser zu werfen. Sie brauchen ungefähr zehn Minuten. Bei der Pasta sollte man drauf achten, dass sie eine Textur hat – sie darf sich nicht glatt anfühlen. Ihr müsst beim Pastakaufen unbedingt darauf achten, dass auf der Oberfläche kleine Reibepunkte drauf sind.
Wenn ihr beim Zwiebelschälen nicht heulen wollt, dann steckt euch einfach ein Holzstück in den Mund. Oder eben wieder das Messer. So sind eure Muskeln beschäftigt, und ihr habt keine Zeit zum Heulen. So, die Äpfel und die Zwiebeln werden jetzt so lange gekocht, bis sie eine schöne Karamellfarbe haben. Dazu fängt man zunächst mit etwas Olivenöl an. Drei Suppenlöffel. Dann gebt ihr etwas Butter dazu, vielleicht halb so viel wie Öl. Parallel setzt ihr das Wasser auf. Sobald Zwiebel, Äpfel und Butter braun werden, kann man Salz dazugeben. Wenn man es zu früh macht, dann wird das ganze Wasser aus den Zutaten gezogen. Mit dem Salz ist es auch so eine Sache: Wenn man viel braucht, zum Beispiel für das Kochwasser für die Nudeln, dann sollte man billiges nehmen. Wenn es um den Geschmack geht, bevorzuge ich Meersalz. So, das Gemüse ist halb durch. Der ideale Zeitpunkt, um die Nudeln ins Wasser zu werfen. Sie brauchen ungefähr zehn Minuten. Bei der Pasta sollte man drauf achten, dass sie eine Textur hat – sie darf sich nicht glatt anfühlen. Ihr müsst beim Pastakaufen unbedingt darauf achten, dass auf der Oberfläche kleine Reibepunkte drauf sind.
So, wenn wir jetzt das Salz in das Wasser werfen, dann stoppt es erst mal das Kochen – das Salz reduziert die Temperatur, deswegen nehm ich sehr viel Wasser.
 So, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, Senfkörner und Peperoni an den Apfel und die Zwiebel zu geben. Und Weißwein – schließlich sind die Samen und Peperoni ja dehydriert, sie brauchen Flüssigkeit, um wieder aufzublühen. Hmm, ich habe die frischen Kräuter vergessen. Nun, dann nehmen wir halt getrockneten Oregano. Diesen fügt man hinzu, während es noch feucht ist, frische Kräuter erst am Ende. Die Pasta sieht schon gut aus, aber ist noch etwas zu wenig durch. Trotzdem nehmen wir sie raus, schwenken sie ab und tun sie in die Pfanne.
So, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, Senfkörner und Peperoni an den Apfel und die Zwiebel zu geben. Und Weißwein – schließlich sind die Samen und Peperoni ja dehydriert, sie brauchen Flüssigkeit, um wieder aufzublühen. Hmm, ich habe die frischen Kräuter vergessen. Nun, dann nehmen wir halt getrockneten Oregano. Diesen fügt man hinzu, während es noch feucht ist, frische Kräuter erst am Ende. Die Pasta sieht schon gut aus, aber ist noch etwas zu wenig durch. Trotzdem nehmen wir sie raus, schwenken sie ab und tun sie in die Pfanne.
 Noch zwei Sachen. Das hier ist Zimt, ein Gewürz aus der Neuen Welt, es passt sehr gut zum runden Eindruck des Essens. Aber erst kurz vor dem Ende hinzugeben, sonst geht der Geschmack verloren. Und zuletzt noch ein paar Kräuter. Frische Minze wär jetzt ideal – wenn wir sie dahätten. Noch ein paar Kapern drauf. Und zuletzt der trockene Parmesan. Das ist wirklich wichtig. Viele denken, das sei ein Bonus. Ich sage: Der Käse ist das, was du wirklich isst. Die Pasta ist nur das Vehikel für den Parmesan. Noch etwas Salz, ein bisschen roten Pfeffer.
Noch zwei Sachen. Das hier ist Zimt, ein Gewürz aus der Neuen Welt, es passt sehr gut zum runden Eindruck des Essens. Aber erst kurz vor dem Ende hinzugeben, sonst geht der Geschmack verloren. Und zuletzt noch ein paar Kräuter. Frische Minze wär jetzt ideal – wenn wir sie dahätten. Noch ein paar Kapern drauf. Und zuletzt der trockene Parmesan. Das ist wirklich wichtig. Viele denken, das sei ein Bonus. Ich sage: Der Käse ist das, was du wirklich isst. Die Pasta ist nur das Vehikel für den Parmesan. Noch etwas Salz, ein bisschen roten Pfeffer.
So: If you get a piece and you might decide you wanna have a little bit of excitement in your life – you can eat it. Bon appetit!“