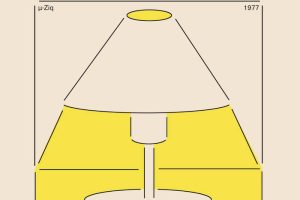Jens Balzer: “eine Art reflektiertes Flaneurstum”
Kannst du dich an den ersten musikjournalistischen Text erinnern, den du gelesen hast?
Jens Balzer: An den ersten Text kann ich mich nicht erinnern, aber an eine erste Kolumne. So zirka 1983, mit 14 Jahren, fing ich an, regelmäßig das Magazin ME/Sounds zu lesen und wurde sofort zum großen Fan der Kolumne von Harald InHülsen. Darin wurde fast ausschließlich Musik besprochen, die so extrem war, dass sie nicht im (obwohl damals dank zum Beispiel John Peel und Alan Bangs noch sehr avancierten) Radio lief, also etwa: die frühen Swans und Sonic Youth, Psychic TV, Coil, Test Dept., Lydia Lunch, Current 93, Big Black … das war sprachlich so eindringlich und leidenschaftlich, dass man (oder zumindest ich) diesen obskuren Kram sofort hören wollte, und um da ranzukommen, musste man aus dem Dorf in die große Stadt reisen und sich in äußerst obskure Schallplattenläden mit noch obskureren Schallplattenverkäufern trauen – perfect match!
Gibt es ein Schlüsselerlebnis, das in dir den Wunsch geweckt hat, selbst musikjournalistisch zu arbeiten?
Das war eher ein Zusammenhang von Leuten: die Redaktion des Magazins „Glas’z“, das Anfang der 90er in Hamburg entstand, im Umfeld der Hamburger Schule. Wir kamen alle aus dem Nachtleben, hingen in den gleichen Bars auf der Reeperbahn herum, hörten am liebsten Musik und schrieben darüber, und weil uns sonst keiner drucken wollte, druckten wir uns halt selber.
Aber wichtiger als das Schreiben waren eigentlich die Redaktionssitzungen in den Bars auf der Reeperbahn und die Release-Partys in den Bars auf der Reeperbahn. Damals dachte ich: ach, wenn das Journalismus ist, dann ist das doch vielleicht gar nicht so schlecht. Leider hatte niemand Lust, sich um Marketing und Vertrieb zu kümmern, das war für das dauerhafte Überleben des Magazins ungünstig. Einige aus der Redaktion gingen ins Musikbusiness, andere wurden Journalisten, wieder andere eröffneten Schokoladen-Läden.
Als ich selber anfing, als professioneller Feuilletonist zu arbeiten, so um 1995 herum, schrieb ich zunächst vor allem über Comic, Literatur, Philosophie. 1999 erhielt ich dann das Angebot, ins Feuilleton der Berliner Zeitung zu gehen. Dort betreute ich zunächst das Ressort Geisteswissenschaften, fing aber nebenher an, immer mehr über Konzerte und Klubnächte zu schreiben, zum einen, weil das sonst niemand machte – es gab damals im Feuilleton der Berliner Zeitung, kein Witz, fünf Theater- und drei Opern-Redakteur*innen, aber niemanden für Pop, weil man das unseriös fand – und zum anderen, weil Pop im Berlin jener Zeit so ein aufregender Gegenstand war – beim Schreiben darüber ging es gerade nicht nur um Musik, sondern vor allem darum, wie sich im Wandel der Szene auch der rasante Wandel der Stadtgesellschaft spiegelte. Ab 2003 habe ich das Feuilleton als Vize-Chef mitgeleitet, war also auch mit vielen anderen Dingen (Kulturpolitik, politisches Feuilleton) neben der Musik beschäftigt. Als hauptberuflicher Musikjournalist habe ich nie gearbeitet.
Was reizt dich am Format Musikjournalismus? Was zeichnet für dich guten Musikjournalismus aus?
Wenn ich über Musik geschrieben habe, dann waren das fast immer Konzertkritiken, Reportagen aus Klubnächten, Glossen über die Szene. Mich reizt das Flanieren, das Erkunden von Orten; mich haben die Leute, die in Konzertsälen Musik hören oder die in Klubs tanzen, immer genauso interessiert wie die Musiker:innen auf der Bühne oder hinter den Decks – welche Rückkopplungseffekte gibt es ? Wie sind die Vibes, was funktioniert an einem Abend und was nicht, und wie kann ich mich als (un-)beteiligter Betrachter dazu in Beziehung setzen?
Was mich nie – oder nur in sehr, sehr seltenen Fällen – interessiert hat, das sind: Interviews mit Musiker:innen und Bands (am besten noch 30 Minuten in einem Hotelzimmer oder heute per Zoom, my ass); und ich finde auch Albumkritiken bis heute eher uninteressant. Guter Musikjournalismus handelt zuerst von Musik, das heißt: er beschreibt, wie sich etwas anhört und anfühlt, wie es gemacht ist, was die Klänge als solche bedeuten, wie Leute in Konzerten oder in Klubs darauf reagieren – und er versucht Leuten, die das noch nicht gehört haben, genau dies in sprachlicher Form zu vermitteln. Schlechter Musikjournalismus überspringt die Musik, um sich gleich den – echten oder vermeintlichen – „Botschaften“ der Musiker:innen zuzuwenden: Ist das jetzt ein toller Ausdruck von: Empowerment, Diversity, Inclusion (oder bitte irgendwas anderes eintragen, was gerade zeitgeistgemäß ist). Das ist im Zweifelsfall schön und gut, aber wenn die Musik nichts taugt, dann taugt auch die Botschaft nichts, und andersherum: Es gibt so viel interessante Musik da draußen, die von politisch zweifelhaften Typen stammt, die man auf diese Weise nicht in den kritischen Griff bekommt.
Gibt es einen Lieblingsbeitrag (von anderen Musikjournalist:innen)?
Das beste Interview der vergangenen Jahre. Andreas Borcholte, einer von Deutschlands besten Popkritikern, spricht mit dem klügsten britischen Musiker seiner Generation, Jason Williamson von den Sleaford Mods, über Politik, Populismus und die unerledigten Aufgaben der Linken.
Dieselbe Frage auch für dich selbst: welchen Beitrag aus deinem Werkskatalog ordnest du aktuell als deinen wichtigsten ein?
Keine Ahnung, ob das mein wichtigster oder überhaupt ein wichtiger ist. Aber vielleicht drückt sich darin ganz gut aus, was ich für die Aufgabe des Popkritikers halte: eine Art reflektiertes Flaneurstum, also an Orte oder in Konzerte zu gehen, die einem grundsätzlich eher fremd sind, und dort zu verstehen versuchen, was die Menschen, die man dort trifft, begeistert. Ob mir das in diesem Fall gelungen ist, müssen andere entscheiden.
Gibt es einen unveröffentlichten Beitrag von dir, den du schon immer gerne mal publizieren wolltest, es sich aber nicht ergeben hat? Kaput biete sich im Rahmen der Serie gerne dafür an. 😊
Ich war für das Feuilleton der ZEIT bei meinem Lieblingskünstler Scooter, als er im Sommer 2023 ein Open-Air-Rave auf dem Flughafen Westerland auf Sylt veranstaltete. Der Text wurde nicht gedruckt, weil die folgende Ausgabe ausschließlich aus Martin-Walser-Nachrufen bestand.
Deine 3 Lieblings-Musikjournalist:innen?
Julie Burchill. Die Königin meiner Jugend. Witzig, ungerecht, furchtlos, immer inspiriert. Das Idealbild einer Kritikerin alter Schule. They don’t make women like her anymore.
Birgit Fuß. Meine Lieblingskollegin schon deswegen, weil sie ausschließlich Musik mag, die ich nicht leiden kann – aber trotzdem in ihren Texten immer dazu in der Lage ist, mir zu erklären, warum das gut und interessant ist, worüber sie schreibt (U2, my ass). Und ich mich eventuell irre.
Aida Baghernejad. Die beste Kritikerin der jungen Generation, mit einem weiten Interesse und einem selten gewordenen Sinn für Musik als solche, aber immer auch mit einem politischen Anspruch in ihren Texten.
Du bist selbst seit den 90er Jahren als Autor aktiv. Was sind die einschneidendsten Veränderungen in deinem persönlichen Berufsprofil über diesen Zeitraum?
Ich hab 1995 als freier Autor anfangen und war dann von 1999 bis 2017 Redakteur, später Vize-Feuilletonchef bei der Berliner Zeitung. Als die Zeitung endgültig kaputtgespart und ruiniert war, habe ich dort meinen Abschied genommen und bin seitdem wieder freier – das war biografisch natürlich erstmal der stärkste Einschnitt. Seither arbeite ich vor allem für das Feuilleton der ZEIT, den Rolling Stone und Deutschlandfunk Kultur; einen Großteil der Zeit verbringe ich aber mit dem Schreiben von Büchern, von denen die meisten entweder einen historischen Fokus haben oder aber eher essayistischer Natur sind. Von der reinen Musikkritik habe ich mich weitgehend verabschiedet. Was natürlich aber auch mit dem Alter zu tun. Bis Anfang 50 hatte ich überhaupt keine Probleme damit, jede Woche in mindestens drei Konzerte zu gehen und am Wochenende ins Berghain. Aber jetzt – man kann es nicht schönreden – lässt die Kondition doch langsam nach.
Und über den eigenen Horizont hinaus: wie empfindest du den Status Quo des Biotops Musikjournalismus im Jahr 2024 im Vergleich zu früher?
Es gibt enorm viele junge Autor*innen, die ich sehr gut finde und die sich in den verschiedensten Medien bewegen; in den verbleibenden Magazinen und Feuilletons, in Podcasts, im Radio … vom reinen Aufkommen her, gibt es heute wahrscheinlich mehr Musikjournalismus als je zuvor. Freilich findet dieser in kleineren, fragmentierten Öffentlichkeiten statt, man könnte er auch sagen: Musikjournalismus kocht zusehends im eigenen Saft.
Das schönste Feedback, das ich in meiner Zeit bei der Berliner Zeitung hatte, kam von Leser*innen, die sagten: wir würden im Leben nicht in diese komischen Konzerte gehen, über die Sie da immer so schreiben, aber wir sind froh, dass uns jemand erzählt, was in der Stadt sonst noch so los ist. Und im besseren Fall konnte man die Leute dann auch dafür interessieren, sich das doch mal wenigstens anzuhören.
Diese Kanäle für Popkritik in eine breitere Öffentlichkeit gibt es kaum noch, weil die Feuilletons verschwinden und aus den Feuilletons zuerst die Popkritik. Das birgt für die nächste Generation an Kritiker*innen aber auch die Gefahr, dass sie eh nur noch für ihre klar umrissenen Zielgruppen schreibt – und außerhalb deren dann gar nicht mehr verstanden wird. Und natürlich ist mein Lieblingsgenre, die Konzertkritik, inzwischen fast völlig verschwunden. Es gibt nicht mal mehr in Berlin eine Zeitung, die das noch ernsthaft betreibt – von den vielen Lokal- und Regionalzeitungen im Lande ganz zu schweigen.
Wenn ich auf meinen Lesereisen in der sogenannten Provinz unterwegs bin, treffe ich immer wieder auf Veranstalter*innen, die darüber klagen, dass über ihre Konzerte / Lesungen / Theateraufführungen / was immer einfach niemand mehr berichtet, weil die Regionalzeitungen ihre – wenn sie überhaupt noch welche haben – bloß noch mit dpa-Meldungen bestücken. Hier hat sich wirklich etwas verschoben und leider nicht zum Günstigen hin.
(Wie) kann man Musikjournalismus in das Storytelling von TikTok und Instagram überführen?
Keine Ahnung, interessiert mich, ehrlich gesagt, auch nicht.
Stichwort Karriere. Ab wann war Musikjournalismus für dich eine Berufsoption?
War es nie, siehe oben. Ich bin ins Feuilleton so reingerutscht, eigentlich bereitete ich mich gerade auf eine akademische Karriere vor, als das Angebot kam, eine Redakteursstelle bei der Berliner Zeitung zu übernehmen, und erst, als ich da schon eine Weile gearbeitet hatte, begann ich mich stärker auf die Musik zu konzentrieren.
Bereust du die Berufswahl manchmal?
Nein.
Letzter musikjournalistische Beitrag, der dir so richtig gut gefallen hat.
Zu den betrüblichsten Entwicklungen des vergangenen Jahres zählt diese ganze verspätete naive Herumschreiberei am Phänomen Taylor Swift – in der sich zweitens auch noch zeigt, wie komplett auf den Hund gekommen der Begriff des „empowerment“ in der Popkritik und auch sonst ist. Dieser Text von Hannah Williams stellt klar, worum es wirklich geht.