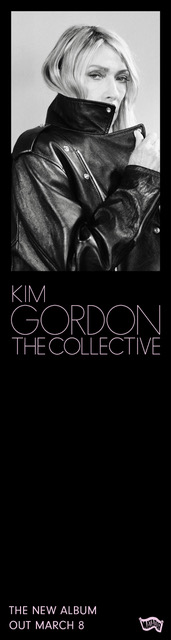Joachim Hentschel “Man fragt sich, an welchen Orten die jungen Talente eigentlich noch lernen und üben sollen”
Kannst du dich an den ersten musikjournalistischen Text erinnern, den du gelesen hast? (Wenn ja: um was drehte er sich? Was gefiel dir daran besonders?)
Joachim Hentschel: Es muss ein Text über den amerikanischen Sänger Leif Garrett gewesen sein, den ich mit neun Jahren im Frühjahr 1979 in der deutschen Jugendzeitschrift „Rocky – Das Freizeit Magazin“ las, die Titelstory des ersten Popmagazins, das ich je in die Hände bekam. Obwohl es wirklich lange her ist, weiß ich noch, dass es um ein Prominenten-Tennisturnier ging, an dem Leif Garrett teilnahm. Mir gefiel daran besonders, dass es ausschließlich um das Thema ging, das mich in dem Moment am meisten interessierte (Musik und ihre Protagonisten), dass der Text das nicht kaschierte oder verbrämte und dass er mich gleichzeitig ernst nahm, also nicht in Kindersprache geschrieben war, wie das meiste, was ich damals für meine Zielgruppe vorfand (denn ich war ja noch ein Kind).
Gibt es ein Schlüsselerlebnis, das in dir den Wunsch geweckt hat, selbst musikjournalistisch zu arbeiten?
Während meiner Unizeit in Tübingen in den 90ern arbeitete mein damals bester Freund Oliver Fuchs für die Lokalzeitung und schrieb dort viele Artikel über Popkultur. Manchmal ging ich mit zu den Konzerten, die er dafür besuchte, oder auch zu seinen Interviewterminen. Hinterher kaufte ich mir die Zeitung und las völlig erstaunt, was er in seinen Texten aus diesen oft doch sehr banale Ereignissen alles Fantastisches herausholte. Das ließ in mir den Wunsch wachsen, sowas auch selbst zu probieren.
Was reizt dich am Format Musikjournalismus? Was zeichnet für dich guten Musikjournalismus aus?
Vieles von dem, was ich am Musikjournalismus schätze, gilt genau so auch für den Journalismus über andere Themen (ich selbst arbeite ja auch noch in anderen Ressorts). Musikproduktion und -darbietung ist ja nicht per se immer etwas Rätselhaftes, Mehrdimensionales oder künstlerisch besonders Wertvolles – daher finde ich Musikjournalismus dann so richtig großartig, wenn er in einer Erscheinung die eigentliche Geschichte entdeckt, wenn er beschreibt, was hier eigentlich gerade wirklich passiert (sofern es da etwas gibt, und das sind ja oft Punkte des Übergangs, die man als Publikum zwischen Zerstreuung, Eskapismus und dann plötzlich geschehender Emanzipation gar nicht sofort bemerkt), die Puzzleteile zusammensetzt und erklärt, warum es in einem bestimmten Fall eben um viel mehr geht als um reine Unterhaltung.
Früher wurden Magazine noch gebraucht, um Basisinformationen zu vermitteln (zum Beispielwie heißen die Jungs von Duran Duran eigentlich und wann haben sie Geburtstag? Und wie klingt das neue Blondie-Album?). Dass sie das dank Wikipedia, YouTube, Streamingdiensten etc. heute nicht mehr tun müssen, ist ein großer Gewinn – leider macht es aber auch große Teile der erscheinenden Musiktexte obsolet, denn sie gehorchen noch den alten Regeln. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als 150 Zeilen über ein Phänomen schreiben oder lesen zu müssen, das keines ist.
Gibt es einen Lieblingsbeitrag (von anderen Musikjournalist:innen)?
Ich liebe die Kolumne abgöttisch, die der englische Journalist Tom Hibbert in den 90er-Jahren für das Magazin Q schrieb: „Who The Hell Does XY Think He/She Is?“ Der Grundgedanke war, dass Hibbert Interviews mit querulantischen/umstrittenen Prominenten wie Margaret Thatcher, Benny Hill, Chuck Berry, Paul Gascoigne, Ringo Starr, Yoko Ono, Cliff Richard etc. führt und von diesen Begegnungen so ungeschminkt wie möglich berichtet. Die Texte sind zwar nicht politisch tiefgehend und oft auch argumentativ schludrig, aber absolut beispiellos in ihrer Klarsicht, Respektlosigkeit, in ihrem eleganten Defätismus und ihrer sprachlichen Virtuosität. Natürlich spielt Hibbert darin eine Rolle, aber sie ist ungeheuer produktiv und war zu dieser Zeit (und erst recht in der heutigen, in der Zugang zu Prominenten fast nur noch durch Affirmation funktioniert) einzigartig.
Hier zum Beispiel sein Text über Roger Waters, aber es gibt noch bessere (leider nicht im Netz):
Dieselbe Frage auch für dich selbst: welchen Beitrag aus deinem Werkskatalog ordnest du aktuell als deinen wichtigsten ein?
Ich habe vor zwei Jahren ein Buch über den popkulturellen Grenzverkehr zwischen DDR und BRD geschrieben („Dann sind wir Helden“), das war im Prinzip auch Musikjournalismus. Und weil ich hier viel Zeit hatte, Aufwand treiben konnte und neue Zusammenhänge entdeckte, ist es inhaltlich der Text, mit dem ich mit weitem Abstand am zufriedensten bin.
Da das vermutlich nicht zählt, würde ich sagen: Ein Süddeutsche-Zeitung-Text über die Groupie-Thematik rund um die Vorwürfe gegen Rammstein ist vielleicht der wichtigste aus der letzten Zeit. Weil hier nicht (wie meistens sonst) irgendeine Veröffentlichung oder ein Termin der Anlass war, sondern eine spontane Eingebung, nachdem ich von der Lindemann-Geschichte hörte. Zudem habe ich (obwohl ich qua Alter, Geschlecht und Herkunft zur Kohorte der alten weißen Männer gehöre) hierzu sehr viel positives Echo von viel jüngeren sowie politisch engagierten Frauen bekommen, was ich ein Stück weit als Erfolg für diesen speziellen Text werte.
Deine 3 Lieblings-Musikjournalist:innen?
John Jeremiah Sullivan – weil er aus seinen Themen große, weitschweifende, durch und durch relevante Erzählungen macht
Jude Rogers – weil sie (u.a. in ihrem tollen Buch „The Sound of Being Human“) das Private/Autobiografische und das Politische/Universelle grandios in den Zusammenhang setzt, in dem es nun mal zueinander steht
In Deutschland gibt es so viele tolle Leute, von Aida Baghernejad und Julia Lorenz über Dietmar Dath und natürlich Diedrich Diederichsen, dazu Torsten Groß, André Boße und natürlich dich, Thomas, bis zu Andreas Müller und Martin Böttcher mit ihrem herrlichen Entgiftungspodcast „Pop nach 8“, dass ich hier unmöglich eine einzelne Person nennen kann.
Höchstens noch: den für mich konkurrenzlosen Andreas Banaski, der leider nicht mehr unter uns ist und keine Anthologie hinterlassen hat.
Du bist selbst seit den 90er Jahren als Autor aktiv. Was sind die einscheidendsten Veränderungen in deinem persönlichen Berufsprofil über diesen Zeitraum?
Die allgemeine Nachfrage nach (überhaupt oder halbwegs angemessen bezahlten) Musiktexten ist in dieser Zeit immens gesunken. Da ich nicht mehr ausschließlich von ihnen lebe (so wie damals), hat das für mich zum Glück noch keine allzu schweren Konsequenzen, aber das kann noch kommen.
Die Zugänge zu den Themen der großen Musikindustrie sind schwerer geworden, die Begehrlichkeiten und der Kontrollwahn (Sperrfristen, Interviewautorisierung etc.) wachsen.
Da die Leserschaft einzelner Beiträge heute einfacher denn je gemessen werden kann, sind Texte über interessante, aber noch wenig populäre Themen viel schwieriger zu platzieren als früher. Im Sinne von: Warum sollten wir einen Text über einen Newcomer bringen, den am Ende nur 500 Leute lesen?
Und über den eigenen Horizont hinaus: wie empfindest du den Status Quo des Biotops Musikjournalismus im Jahr 2024 im Vergleich zu früher?
Im Prinzip ist er natürlich reicher denn je, mit tollen Podcasts und Videoformaten, im Internet überlebenden Magazinen, Deluxe-Printprodukten wie dem neuen The Face, Das Wetter, Diffus oder dem mittlerweile ziemlich tollen, generalüberholten US-Rolling Stone bis zum Popangebot von Blogs und Zeitungen wie Vulture oder sogar dem Daily Telegraph.
Allerdings hat man das Gefühl, dass die Eintrittshürden höher werden, und man fragt sich, an welchen Orten die jungen Talente eigentlich noch lernen und üben sollen, damit sie irgendwann groß werden können. Es sieht trübe aus – vermutlich kann bald nur noch reüssieren, wer selbstausbeuterisch genug ist und wirklich eine Alternative zu KI-Veranstaltungstipps bieten kann.
Und wie oben schon angedeutet: Warum sollte man selbst einen Text schreiben, der erstens schlecht bezahlt ist und zweitens keine Reichweite bekommt? Das ist oft ein schlagendes Argument gegen Musikjournalismus.
(Wie) kann man Musikjournalismus in das Storytelling von TikTok und Instagram überführen?
Man kann über diese Kanäle auf Künstler/innen und News aufmerksam machen, Songs featuren und Memes kreieren. Alles gut und wichtig – aber das, was mir am Musikjournalismus wichtig ist, nämlich die analytische Tauchtiefe, Geduld und Ausführlichkeit lässt sich allein auf diesen Kanälen schlecht leisten. TikTok oder Insta zu benutzen, um Werbung für tiefergehende Text-, Video- oder Audioformate zu machen bzw. Menschen zu ihnen zu führen, das geht allerdings gut.
Stichwort Karriere. Ab wann war Musikjournalismus für dich eine Berufsoption?
Erst, als ich mit viel Glück eine Redakteursstelle beim Rolling Stone angeboten bekam und dafür nach Hamburg zog. Da ich davor in der Provinz wohnte und da einfach kein unmittelbarer Anschluss an große Geschehnisse, Clubs, Konzerte etc. da war, war es vor dem Umzug keine Option.
Bereust du die Berufswahl manchmal?
Nein, weil auch ich durch die Tätigkeit so viel mehr Zugang zum Thema bekommen habe. Wer weiß, wenn ich Englischlehrer oder Buchhändler geworden wäre, würde ich heute vielleicht auch nur noch Ed Sheeran, Deine Freunde und Tina Turner hören.
Letzter musikjournalistische Beitrag, der dir so richtig gut gefallen hat.