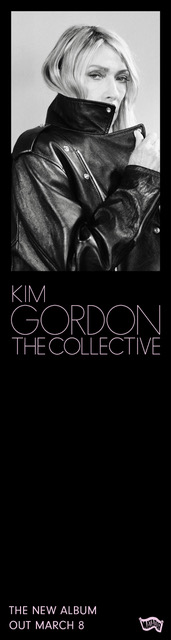Zuhause in Palästina
- Jerusalem
- Hebron
Kaput Autorin Amira El-Kordy hat im vergangenen September ihrer zweiten Heimat Palästina einen Besuch abgestattet. Ein nachhaltiges Erlebnis, dessen Eindrücke sie für uns mit Bildern und Worten aufbereitet hat.
Die Sache mit dem Reisen und Wiederkehren ist ja diese: All die Erinnerungen, Gerüche, Geräusche, Momente und Begegnungen schwirren noch derart präsent im Kopf herum, dass man sich erst einmal etwas verloren in seinem Alltagsleben vorkommt. Damit einher geht das Gefühl, niemandem wirklich nahe bringen zu können, was man alles erlebt hat. Man selbst glaubt, jetzt viel mehr verstanden zu haben von der Welt, aber daheim ist alles so furchtbar unverändert. Ganz schleichend lebt man sich dann wieder ein, irgendwie geht das.
Meine letzte Reise führte mich nach Palästina, in meine zweite Heimat. Oder erste Heimat? Was ist überhaupt Heimat und wie fühlt sich das an? Ist Heimat der Ort, an dem man geboren wurde, wo man aufgewachsen ist? Oder befindet sie sich dort, wo man sich wohl und geborgen fühlt?
Fragen, mit denen man sich einmal mehr auseinandersetzt, wenn man hier lebt und die eigenen Wurzeln in der Ferne liegen – Fragen, die angesichts der aktuell zu attestierenden Massen an flüchtenden Menschen, die sich unter anderem bei uns eine neue Heimat erhoffen, aktueller denn je erscheinen.
Um ins Westjordanland im Nahen Osten zu kommen, muss man viele Grenzen überqueren. Grenzen, die den Flughafen in Tel Aviv von eben dieser Stadt oder Jordanien von Jerusalem oder Jerusalem von Ramallah trennen. Grenzen, die das Leben aller Menschen innerhalb des gesamten Landes regeln, einschränken und kontrollieren. Grenzen, die auch mir zeigen, dass mein deutscher Pass beim israelischen Sicherheitsdienst wertlos ist, denn mein Name und die Herkunft meines Vaters sind Anlass für stundenlange Befragungen und Untersuchungen.
Nicht, dass ich diese Prozedur nicht schon erwartet und mir vorher überlegt hatte, wie die Situation am besten zu handhaben sei. Ich entschied, kein Märchen vom Strandurlaub in Tel Aviv und Schnorcheln am Roten Meer zu erzählen, sondern bei der Wahrheit zu bleiben; vermutlich wussten sie eh schon längst Bescheid: „Ja, ich fahre in die West Bank.“
Schon auf europäischem Flughafenboden regnete der Fragenhagel auf mich ein:
„Amira, das ist aber kein deutscher Name?“
„Wie ist die Beziehung zu Deinem Vater?“
„Wen wirst Du treffen während Deines Aufenthalts?“
„Wann und aus welchem Grund warst Du zuletzt im Land?“
„Wie finanzierst Du diese Reise?“
„Sprichst Du Arabisch?“
Vermeintlich harmlose Fragen, deren Antworten mit größtem Argwohn begutachtet, ja sogar eins zu eins verschriftlicht werden. Rückblickend kann ich nicht genau sagen, woran es lag, dass ich beim Umstieg in Zürich der Airline verwiesen wurde. Nachdem ich dort vom israelischen Security Supervisor durch verwinkelte Korridore in einen kleinen Raum unterhalb des Flughafens geführt wurde, alle Habseligkeiten abgeben und mich entkleidet einer körperlichen Durchsuchung fügen musste, teilte man mir mit, ich sei nicht berechtigt mitzufliegen. Und jetzt solle ich verschwinden.
Zurück am Gate kümmerte sich ein Schweizer Flughafenarbeiter dann um meine Umbuchung. Paris also, und von dort nach Tel Aviv. Wenige Minuten nach der Landung kurz vor Mitternacht stehe ich schon in der endlosen Schlange für die Passkontrolle. Ein kurzer Blick in meinen Pass genügt; die Beamtin erhebt sich wortlos von ihrem Platz in dem kleinen verglasten Häuschen, nickt mir teilnahmslos zu ihr zu folgen und weist mich in den kargen Wartebereich. Meinen Pass sehe ich die nächsten fünf Stunden nicht wieder. Stattdessen werde ich irgendwann in einen hässlichen, kalten Raum gerufen, in dem ich abwechselnd in die strengen Gesichter der israelischen Offiziere und auf die der an der Wand eingerahmten Bilder von Sharon, Olmert und Netanjahu schaue.
Ich bin müde, aber noch viel mehr: wütend. Meine Tränen kann ich nicht mehr zurückhalten, während ich wieder und wieder die gleichen Fragen zu meinem Leben und meinen Reiseplänen beantworten und mein iPhone entsperren muss, damit sie Bilder und Rufnummern durchforsten können. Sie kennen die Namen und Geburtsorte meiner Großeltern in Gaza. Sie schreien mich entweder an oder äußern sich abfällig lächelnd, dass ich lüge, dass ich falsche Gründe für meine Reise angebe , dass sie mir nicht glauben, ich würde keine feste Verabredung mit einem Palästinenser vor Ort haben. Ich kann nicht mehr einschätzen, ob sie mich bewusst einschüchtern und schikanieren, oder tatsächlich in dem paranoiden Glauben sind, ich sei eine ernstzunehmende Gefährdung für die Staatssicherheit. Irgendwann, als mir jemand meinen Pass in die Hand drückt, wird mir endlich Eintritt in das Land gewährt wird.
Tel Aviv ist die vibrierende Stadt, jung, hip und weltoffen. Ein großer Teil des Lebens spielt sich hier am Strand und in den Straßen voller kleiner Cafés und Nachtclubs ab. Jerusalem hingegen ist noch immer sehr traditionell geprägt. Ein Ort voller jahrhundertalter Geschichte reiht sich an den nächsten, drei Weltreligionen (Islam, Judentum und Christentum) und ihre heiligsten Stätten liegen so nah beisammen. Ich empfinde die Stimmung in der Stadt oft als angespannt, vielleicht auch, weil das israelische Militär (Israel Defence Forces/ IDF) omnipräsent ist. Einmal finde ich mich in der Tram eingequetscht zwischen ein paar uniformierten Soldaten, die sich munter unterhalten. Maschinenpistole und Schlagstock drücken sich an meinen Arm. Auf ihren Handys klebt ein blau-weißer Aufkleber, der die israelische Flagge zeigt. Neben mir laute Teenager und ultraorthodoxe Familien mit quengelnden Kindern. Eine ganz normale Alltagssituation in Jerusalem. An jenem Tag sitze ich nur kurze Zeit später in einem alten Bus, der schaukelnd die Landstraßen entlang fährt. Es ist einer der vielen Busse, die mehrmals in der Stunde von Jerusalem nach Ramallah, in die Hauptstadt der West Bank, fahren.
- Checkpoint Qalandiya
- Separation Wall Bethlehem
- Separation Wall Bethlehem
- Ramallah
- Hebron
- Nablus
Am Qalandia Checkpoint, dem größten und meist frequentierten Checkpoint des Gebiets, warnt ein riesiges Schild israelische Staatsbürger vor der Weiterfahrt in palästinensische Gebiete der Area A. Dies ist eine der drei Zonen, in welche die West Bank eingeteilt ist. In Area A lebt der Großteil der Bevölkerung, palästinensische Behörden verfügen über autonome Regierungsgewalt. Unter Area B fallen große ländliche Bereiche, Israel teilt sich hier zusammen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde, die über zivile Angelegenheiten entscheidet, die Verwaltung. Etwa 60% der West Bank gehören zu Area C und unterliegt damit der totalen Kontrolle Israels. Das bedeutet einen Eingriff in alle täglichen Belange der arabischen Zivilbevölkerung, darunter Bewegungseinschränkungen und Kontrolle über Wasserzufuhr und des Ausbaus von Infrastruktur. Die Einteilung in die drei Zonen besteht seit 1995 und wurde im Rahmen des Osloer Friedensprozesses vorgenommen.
Die Prozedur am Checkpoint erweist sich oft als langwierig, vor allem zu den Stoßzeiten, wenn Palästinenser zur Arbeit nach Jerusalem und zurück die Grenze passieren müssen. Touristen haben hier ein leichteres Durchkommen, alle mit einem palästinensischen Ausweisdokument jedoch müssen verschiedene vom IDF und der israelischen Polizei geführte Stationen durchlaufen.
Nach knapp 40 Minuten Busfahrt steige ich auf einem belebten Vorplatz in der Stadtmitte von Ramallah aus, sehe andere Menschen, atme vertraute Gerüche, höre neue Stimmen, Geräusche und arabische Musik, die aus allen Ecken die Straßen beschallt.
In den nächsten zehn Tagen werde ich von hier aus andere Städte in der West Bank besuchen, darunter Nablus, Jenin, Bethlehem und Hebron – und an jedem Abend auf der Rückfahrt nach Ramallah in einem vollgepackten Sherut auf holprigen, einsamen Straßen sitzen, meine Nase fest an die Scheibe gedrückt, damit ich jeden Moment der wunderschönen Aussicht auf Olivenhaine, Geröllwüste und verlassene Dörfer mitnehmen kann.
An allen Orten werde ich mehr als herzlich und gastfreundlich aufgenommen. Ich trinke Tee und esse Baklava mit fremden Menschen, die mich in ihr Haus einladen, spiele mit Kindern auf der Straße, und bekomme riesige Tüten gefüllt mit frisch gebackenem Brot geschenkt. Die Palästinenser sind sehr neugierig ohne aufdringlich zu sein, und ich bemerke die große Freude und auch so etwas wie Stolz, dass man herkommt und sich für sie interessiert. So oft ich in Deutschland die Interaktion mit Fremden meide, so sehr finde ich Gefallen daran, mich über mein Leben und meinen Besuch in Palästina mit den Menschen dort an jeder Straßenecke auszutauschen. Spätestens nachdem ich meinen Namen genannt habe, werde ich mit übereifrigen Willkommensgrüßen überschüttet und nutze die Gelegenheit, mehr über das Leben der Person vor mir zu erfahren.
Oft ist es nur ein kurzer Einblick, ein paar Straßen, die man zusammen läuft und sich soweit es die Sprachbarriere zulässt auf Englisch und Arabisch unterhält, ein Kaffee an der Ecke oder ein Plausch auf einer Bank, und doch habe ich danach das wohlige Gefühl, ein Stück mehr meiner Heimat mitzunehmen.
Mohammad Wassef lerne ich im Hostel in Ramallah kennen, in dem er fast jeden Tag vorbei schaut und ab und zu aushilft. Er erzählt, wie ihn die Begegnungen mit den Reisenden bereichern, wie sie ihm Einblicke in eine fremde Welt gewähren, von der er nur ahnen kann, wie sie anmutet. Er wünscht sich, die vielen Freunde und Bekannte aus der ganzen Welt, die er im Laufe der Jahre gemacht hat, besuchen zu können. Bisher hat er nur ein einziges Mal die West Bank verlassen; mit einer speziellen Genehmigung durfte er nach Jerusalem.
Ich versuche in Worte zu fassen, wie mein Leben Zuhause aussieht, wie ich lebe, arbeite, wohne und herum reise. Einmal mehr merke ich, wie unterschiedlich uns unsere Orte prägen, wie sich die Perzeption von Dingen verändert und was die Gesellschaft, in der man aufwächst, für einen enormen Einfluss auf Charakter und Denkweise hat. Und welche grundlegenden Privilegien man im Westen besitzt, deren Existenz sich viele Menschen nicht genug bewusst sind.
Ramallah ist als kulturelles Zentrum der West Bank sehr offen und modern. Ein Ort, an dem man leicht zurecht kommt als Reisender. Ich möchte unbedingt noch beim Palestinian Museum vorbeischauen, das kurz vor seiner Eröffnung steht. Noch gibt es keine regulären Öffnungszeiten, ein kurzer Anruf jedoch genügt, um zu einer privaten Führung eingeladen zu werden. Etwas abseits vom Zentrum Ramallahs gelegen befindet sich der architektonisch wunderschöne Neubau, der auf einem Hügel nahe der Birzeit Universität ragt. Der Außenbereich des Museums, entworfen von einem jordanischen Designer, umfasst ein Café und ist umgeben von abgestuften Gärten, bepflanzt mit heimischen Bäumen, Blumen und Kräutern.
Natalie Al-Masri ist Web Content Coordinator des Museums, aber auch für viele andere anfallende Aufgaben zuständig. Sie erwartet mich bereits strahlend und führt mich durch das 2014 erbaute Museum. Die Ausstellungen sollen sich nicht nur auf Kunst, Installationen und Screenings mit dem Fokus auf palästinensische Geschichte, Kultur und Gesellschaft beschränken, erklärt sie. Es werde ebenso Raum für Bildungsprogramme, kreative Unternehmen und Forschungsarbeiten geschaffen, immer in enger Zusammenarbeit und im stetigen Austausch mit internationalen Institutionen und Künstlern.
- Streets of Jaffa
- Streets of Ramallah
- Settlement Hebron
- Streets of Ramallah
- The Palestinian Museum
- The Palestinian Museum
Am Montag fahre ich mit ein paar Leuten nach Hebron. Die größte Stadt in der West Bank ist die einzige, in der die israelischen Siedlungen direkt im Stadtzentrum errichtet wurden. Stacheldraht und Netze über den Gassen der Altstadt ziehen die Linie zwischen arabischen Bewohnern und militanten Siedlern. Auf Aussichttürmen und in den Straßen patrouillieren rund um die Uhr Soldaten, die die etwa 850 Siedler beschützen sollen. In Hebron brodelt der Nahostkonflikt spürbar an der Oberfläche.
Muhanned Qafesha stammt aus Hebron und arbeitet ehrenamtlich bei der Organisation „Youth Against Settlements“. Er führt mich an diesem Tag durch die Altstadt, arrangiert Gespräche mit Bewohnern und erläutert die politische Situation. Die Tour wird unterbrochen als auf einmal ein aufgeregt wirkender Mann auf uns zu kommt und berichtet, dass gerade ein 16-Jähriger Palästinenser an einem der Checkpoints erschossen wurde, nachdem er Steine auf die Soldaten geworfen hatte. Muhanned ist spürbar beunruhigt, und auch mein Herz klopft laut, als wir uns an die Wände der engen Gassen drücken, um den Soldaten im Marschschritt Platz zu machen. Da nun die Tumulte zunehmen und Straßen in der Altstadt gesperrt werden, müssen wir an dieser Stelle die Tour beenden.
In Bethlehem beobachte ich aus dem Auto heraus eine ähnliche Situation, die den Konflikt sinnbildlich verdeutlicht. Fernab der touristischen Stadtmitte, in der die Geburtskirche Jesus’ zu finden ist, fahren wir an der Separation Wall entlang, die hunderte von Bannern und Graffiti (fünf davon von Banksy) zieren. Der Bau der sechs Meter hohen Mauer begann im Jahr 2000 während der Zweiten Intifada zum angeblichen Schutze Israels und misst mittlerweile über 700 km, die 85% der West Bank durchziehen. An einer Straße sind etwa ein Dutzend Jugendliche mit Steinschleudern versammelt, die angriffslustig einen Panzer in der Ferne beobachten, aus dem gerade zwei Soldaten ausgestiegen sind. Unser Taxifahrer erklärt, dass man sich besser nicht in der Nähe solcher Situationen sehen lässt, da sie schnell gefährlich werden können. Auch wenn die Provokation der Jugendlichen leichtsinnig ist, sind die angestaute Aggression und Frustration nachvollziehbar, und die Relation der Machtverhältnisse keine faire.
Die letzten Tage, die ich in Tel Aviv kurz vor meiner Rückreise verbringe, fühlen sich seltsam an. Zu viel ist passiert, als dass ich mich den Einheimischen und Touristen in Feierlaune anschließen kann. In den immer wieder oft kurzen Begegnungen mit Menschen auf beiden Seiten steckt mehr Gehalt, als man im ersten Moment anzunehmen vermag. Einmal stehe ich an einer Ampel in Tel Aviv, als mich ein Mann aus Jerusalem nach dem Weg fragt. So kommen wir ins Gespräch, und als er hört, dass ich in der West Bank unterwegs war, reißt er erstaunt und leicht erschrocken die Augen auf. Ich sei dort alleine gewesen? Ja wieso denn? Ob ich denn keine Angst gehabt hätte?
Ich frage ihn, wovor ich mich fürchten sollte, und er gerät ins Stottern. Es sei ja sehr gefährlich dort, was man alles so hört und liest und mitbekommt, und für ihn herrsche ohnehin schon in der Nähe der Grenze Lebensgefahr. Ich versuche ihm zu erklären, was ich gerne allen erklären würde, die ähnlich reagiert haben: Dass es weniger Vorurteile, weniger Hass und weniger Feindschaft geben muss, mehr Reflektion über Medienberichte, mehr Offenheit und Menschlichkeit. Dass die meisten Palästinenser herzensgute, liebe Menschen sind, dass die West Bank mehr ist als nur ein Krisengebiet und jeder einzelne etwas beitragen kann zu einer friedlicheren Koexistenz, solange es keine langfristige Lösung für den Nahostkonflikt gibt. Ich komme zurück, Palästina.
- Beach of Tel Aviv
- Old City of Jerusalem
- A Boy and two Soldiers
- Souq Ramallah
- A Woman and Child at Qalandiya Checkpoint
- Dome of the the Rock in Jerusalem