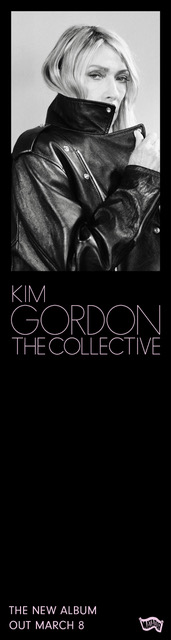Dr. Mithu Sanyal: „Es fällt mir schwer, die Gleise zu überqueren“
Ihre Liebe zu Oberbilk musste sich Dr. Mithu Sanyal erst erarbeiten. Die Journalistin und Autorin wurde 1971 im Stadtteil geboren – und hat fast ihr komplettes Leben hinter dem Bahnhof verbracht.
Alexandra Wehrmann: Frau Sanyal, wie würden Sie jemandem, der Oberbilk nicht kennt, den Stadtteil beschreiben?
Mithu Sanyal: Für mich ist es zunächst mal ein Stadtteil, in dem ich als Person of Color nicht weiter auffalle. Ich passe ins Bild. Oberbilk wurde von Migrant*innen aufgebaut, angefangen mit den belgischen Stahlarbeitern, die im 19. Jahrhundert kamen, um in den zahlreichen Oberbilker Fabriken zu arbeiten. Bis heute hat das Viertel verglichen mit der Gesamtbevölkerung der Stadt einen überdurchschnittlich hohen Anteil an migrantischer und postmigrantischer Bevölkerung. Zudem liegt Oberbilk im Herzen der Stadt. Wenn man als Ortsfremder auf den Stadtplan schaut, könnte man vermuten, dass es das schicke Zentrum Düsseldorfs ist. Das ist es definitiv nicht, trotz der Nähe zum Bahnhof und trotz des Gerichts.
Sie leben mit kleinen Unterbrechungen schon Ihr ganzes Leben in Oberbilk. Ist Oberbilk ein Stadtteil zum Bleiben?
Tatsächlich ist es für viele Menschen eher eine Durchgangsstation. Deshalb findet man auch relativ wenig alteingesessene Oberbilker*innen. Insgesamt polarisiert das Viertel ziemlich stark: Ich kenne nur zwei Gruppen von Bewohner*innen: solche, die schnellstmöglich weg wollen, und solche, die – inzwischen, das ist eine relativ neue Entwicklung – für immer bleiben möchten. Dazwischen gibt es nichts.
Das ist die Innenansicht. Und wie schaut man von außen auf das Viertel hinter dem Bahnhof?
Ich habe beispielsweise Freundinnen, die alles andere als elitär sind, die aber auf keinen Fall in Oberbilk wohnen wollen würden. Auch Schulfreunde meines Sohnes, der das Goethe-Gymnasium in Düsseltal besucht, finden unsere direkte Umgebung krass. Überhaupt gibt es überraschend wenig Freunde aus der Schule, die ihn in Oberbilk besuchen. Zu Hause hat er in erster Linie mit seiner Oberbilker Gang zu tun. Er führt zwei Leben, die unterschiedliche Regeln haben, in denen er unterschiedliche Sprachen spricht.
Sie selbst sind in den siebziger Jahren in Oberbilk aufgewachsen, als Tochter eines indischen Vaters und einer polnischstämmigen Mutter. Warum haben sich Ihre Eltern gerade in Oberbilk niedergelassen?
Meine Eltern haben schlicht und ergreifend als gemischtes Paar nirgendwo anders Wohnraum bekommen. Hier hat es dann geklappt. Sie haben eine Wohnung auf der Sonnenstraße bezogen, in der ich auch aufgewachsen bin.
Wann sind Ihre Eltern nach Deutschland gekommen?
Meine Mutter ist in Deutschland geboren, während des Zweiten Weltkriegs. Sie ist eine geborene Zagorski. Ihre Familie ist wie so viele polnische Familien ins Ruhrgebiet ausgewandert. Wegen ihrer schwarzen Locken wurde meine Mutter als Kind „Möhrken“ genannt, also „kleiner Mohr“. Das zeigt, wie weiß Nachkriegsdeutschland war, weil sie alles andere ja deportiert und getötet hatten. Mein Vater ist in den sechziger Jahren aus Indien nach Deutschland gekommen. Er war Ingenieur. Zu der Zeit wurden gezielt Bengalen aus Ingenieurberufen angeworben. Der Vater meines Vaters hat damals ein Stück Land verkauft, damit sein Sohn sich das One-Way-Schiffsticket nach Europa kaufen konnte. Ursprünglich wollte mein Vater nach England gehen. Aber das Land hat damals die Grenzen geschlossen. So landete er nicht ganz freiwillig in Deutschland. In der International English Library des Bildungszentrums Die Brücke hat er meine Mutter kennengelernt. Mitte der sechziger Jahre war das. Eigentlich wollte mein Vater nur einige Jahre in Deutschland bleiben und dann zurück nach Indien gehen. Es kam allerdings anders. Er lebt heute noch in Oberbilk.
Sie wurden 1971 geboren. Wie erinnern Sie das Oberbilk Ihrer Kindheit?
Oberbilk war damals ziemlich grau. Die bunten Fassaden kamen erst später, in den neunziger Jahren, schätze ich. Die kleinen Seitenstraßen waren noch nicht verkehrsberuhigt. An die Unterführung zwischen Ellerstraße und Mintropplatz kann ich mich gut erinnern, die fand ich total gruselig. Da hat es schrecklich nach Pisse gestunken. Wenn ich sie durchqueren musste, bin ich immer gerannt. Es war mir schon als Kind bewusst, dass ich in einer hässlichen Umgebung aufwachse, in einem vergessenen Stadtteil. Dass es hier in Oberbilk nicht so aussah wie in den Kinderbüchern, die ich las. Eine Freundin von mir ist in Meerbusch aufgewachsen. In ihrer Vorstellung haben alle Kinderbücher auf der Pappelallee hinter ihrem Haus gespielt. Ein vergleichbarer Ort existierte in Oberbilk nicht. Als ich aufwuchs, war man nicht stolz auf den Stadtteil. Man identifizierte sich nicht mit ihm. Gleichzeitig war einem klar, dass man woanders auch nicht hingehörte. Das Viertel zu verlassen, war wie eine Grenze zu einer anderen Welt zu überqueren. Tatsächlich ist Oberbilk ja ein Dreieck aus Gleisen, es gab also diese echte physikalische Grenze, und es gab eine psychologische Grenze. Das empfinde ich übrigens heute noch so. Es fällt mir immer noch schwer, die Gleise zu überqueren. Oberbilk zu verlassen – und sei es nur zum Einkaufen – ist jedes Mal eine bewusste Entscheidung.
Gibt es auch Dinge, die Sie aus dem Oberbilk Ihrer Kindheit positiv in Erinnerung behalten haben?
Der Volksgarten war schon immer traumhaft und verwunschen, auch wenn er zu der Zeit noch kleiner war als heute, weil er erst zur Bundesgartenschau 1987 erweitert wurde. Und die alten Gaslaternen habe ich auch damals schon geliebt. An den Laternen haben wir Rollschuhfahren gelernt. Wir sind daran hochgeklettert. Ihr Licht war immer so viel weicher und tröstlicher als das Licht der elektrischen Straßenlaternen. Nicht zuletzt wegen dieser Erinnerungen ist es mir wichtig, dass die Gaslaternen erhalten bleiben. Dafür habe ich auf jeder Unterschriftenliste, die ich in die Finger bekam, unterschrieben.
Wie muss man sich Ihr Umfeld in den siebziger Jahren vorstellen?
Als Kind spielte ich ausschließlich mit Kindern aus Oberbilk. Ich kannte gar keine Kinder aus anderen Stadtteilen. Der Boden im Stadtteil war übersät mit winzigen Scherben, wahrscheinlich von zerbrochenen Bierflaschen. Wenn ich hingefallen bin und mir die Knie aufgeschlagen habe, hatte ich ständig diese kleinen Scherben im Knie. Ansonsten war die Kirche sehr zentral. St. Josef. Gefühlt waren alle unsere Nachbar*innen katholisch, und alle sind jede Woche in die Kirche gegangen. Die wenigen Freizeitangebote, die es damals für Kinder und Jugendliche im Stadtteil gab, kamen auch von der katholischen Kirche.
Ihr Vater ist Hindu, ihre Mutter, die schon viele Jahre tot ist, war Katholikin. Sie selbst wurden ebenfalls katholisch getauft. Wie kam das?
Das war ein viel diskutiertes Thema zwischen meinen Eltern. Letztlich wurde eine Abmachung getroffen. Wenn das Kind ein Junge wird, wird es Hindu. Wenn es ein Mädchen wird, katholisch. Ich bin in St. Josef getauft worden. Da gab es damals einen ganz tollen Pfarrer: Pfarrer Gail. Ein sehr konservativer Priester, der wahnsinnig charismatisch gepredigt hat. Oberbilk war, als ich ein Kind war, wie gesagt sehr katholisch. Alle gingen zur Messe. Wenn man wegblieb, haben die Nachbarn anschließend gefragt, ob man krank war. Wie auf dem Dorf. Oberbilk war ja auch ein Dorf, durch die Schienen, die den Stadtteil umgaben. Alle kannten alle und wussten alles übereinander. Und die Kirche war das Herz dieser Gemeinde. Nachdem Pfarrer Gail in Rente oder wohin auch immer gegangen war, brach das auseinander. Sein Nachfolger predigte, als hätte er den Mund voller saurer Gurken. Plötzlich hatte das alles keine Bedeutung mehr. Bei meiner Firmung hat mich der Bischof dann nicht einmal mit Mithu angesprochen, wahrscheinlich weil das kein christlicher Name ist, sondern mit meinem zweiten Vornamen, Melanie. Ich hatte damals das Gefühl, dass er eine andere gefirmt hat.
Weihnachten war bei uns auch immer ein schwieriges Thema. Eigentlich wollten meine Eltern es gar nicht feiern – indische Feste haben wir schließlich auch nicht begangen. Ganz kurz vor Heiligabend wurde dann aber doch immer der Plastik-Tannenbaum aus dem Keller geholt und ganz schnell aufgebaut, fast verschämt. Im Rückblick finde ich das tragisch. Warum haben wir nicht einfach alles gefeiert? Stattdessen lebten wir in einer Art kulturellem Vakuum.
Sie haben weder Polnisch noch Bengali gelernt. Welche Sprache wurde bei Ihnen zu Hause gesprochen?
Deutsch. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater noch nicht so gut Deutsch, mittlerweile hat sich das geändert. Den Menschen, die damals nach Deutschland kamen, um hier zu arbeiten, wurden keine Angebote gemacht. Keine Sprachkurse, nichts. Mein Vater war Ingenieur, er hat technische Zeichnungen angefertigt. Am Arbeitsplatz sprach er Englisch. Für mich war es daher schwierig, mit ihm zu kommunizieren. Die gesamte Kommunikation lief über meine Mutter. Bei Behörden. Oder in der Schule. An meinem Gymnasium gab es noch Lehrer, die mich nicht drannahmen, weil sie dachten, ich kann kein Deutsch. In den achtziger Jahren! Unglaublich. Meine weiße deutsche Mutter ging dann immer ganz aufgebracht in die Schule, sie hat meine Lehrer sehr beeindruckt.
Sie selbst hatten in den ersten Lebensjahren einen indischen Pass. Anfang der siebziger Jahre bekamen in Deutschland geborene Kinder noch automatisch die Staatsangehörigkeit des Vaters.
Das stimmt, in Deutschland galt damals das Blutrecht. Deutsch konnte man nur werden, wenn man einen deutschen Vater hatte. Also bekam ich einen indischen Pass. Meine Mutter hat sich in der IAF, der Initiative der mit Ausländern verheirateten Frauen, politisch dafür eingesetzt, dass das geändert wurde. Man muss sich das vorstellen, dass ich als ihre Tochter ihre Staatsangehörigkeit nicht bekommen konnte, weil sie eine Frau war. Der Tag, an dem ich einen deutschen Pass bekam, ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. Das war im Januar 1975, ich war drei Jahre alt. Ich wusste natürlich nicht, was das bedeutete, ein deutscher Pass, nur dass er ungemein wichtig war.
Wie war der gesellschaftliche Umgang mit gemischten Paaren zu der Zeit?
Ehen wie die meiner Eltern waren zur damaligen Zeit noch verhältnismäßig selten und auch nicht wirklich erwünscht. Es wurden viele Ängste geschürt, um deutsche Frauen davon abzuhalten, nicht-deutsche Männer zu heiraten. Ärzte haben beispielsweise meine Mutter gewarnt, dass Kinder aus gemischten Ehen eher zu Depressionen neigen würden. Dazu kam die Angst vor Kindesentführung. Das war eine Urangst vieler Frauen, die wie meine Mutter mit nicht-deutschen Männern zusammenlebten, dass der Ehemann nach einer Trennung mit dem Kind in sein Heimatland zurückkehrt und die Mutter ihr Kind nie wiedersieht. Auch darüber hinaus hatten Paare wie meine Eltern viele Probleme. Für sie war es zum Beispiel schwierig, eine Kirche zu finden, die die Trauung vornahm. Meine Eltern haben, glaube ich, in Duisburg geheiratet. In Düsseldorf war kein Pfarrer bereit, sie zu trauen.
Ihre Oma, die Mutter Ihrer Mutter, lebte ebenfalls in Oberbilk. Wie war das Verhältnis zu ihr?
Sehr eng. Meine Eltern waren beide berufstätig, und ich bin nach der Schule immer zu meiner Oma gegangen und habe bei ihr gegessen. Sie war eine typisch polnische Oma. Einer ihrer Söhne wohnte sein Leben lang bei ihr. Mein ältester Onkel hatte eine Wohnung im Nachbarhaus, und meine Mutter lebte nur eine Straße weiter. Meine Oma hat für ihre Kinder und Enkelkinder gekocht und geputzt. Als Kind fand ich das häufig nervig, weil sie schon morgens um 6 Uhr zu uns kam, um mit unserem Hund rauszugehen und sich dann immer unterhalten wollte. Aber im Rückblick bin ich beeindruckt davon, wie viel sie für ihre Familie getan hat. Und ich habe es geliebt, mit ihr im Sommer und Herbst Himbeeren, Brombeeren und Pilze zu sammeln. Sie hat alles eingekocht, was nicht bei drei auf dem Baum war.
Wie reagierte die polnische Familie auf Ihren Vater?
Meine Großeltern hatten zunächst heftige Probleme damit, dass meine Mutter einen Inder heiraten wollte. Aber meine Mutter hat ihrer Familie klargemacht, dass sie sie nur mit meinem Vater zusammen haben könnten. Nach der Ansage gab es ein paar Wochen Funkstille. Dann hat meine Oma die beiden zusammen zum Essen eingeladen. Von da an war mein Vater ein untrennbarer Teil der Familie, auch weil bengalische Familien ebenfalls sehr auf die Großmütter und Mütter zentriert sind. Als meine Mutter sich viele Jahre später – ich war bereits ausgezogen – von meinem Vater getrennt hat, hat er meine Oma trotzdem weiterhin täglich besucht, um mit ihr Schach zu spielen. Das fand meine Mutter übrigens auch völlig in Ordnung.
Inwiefern haben Sie sich als Kind und Jugendliche mit der Herkunft Ihrer Eltern auseinandergesetzt?
Eine Auseinandersetzung mit der Herkunft der Eltern war damals sehr schwierig. Auch Indisch sein oder Polnisch sein war etwas, was man sich abgewöhnen sollte und zwar so schnell wie möglich. Das fing damit an, dass Kinder bloß nicht die Muttersprache ihrer nicht-deutschen Eltern lernen sollten. Mit der Begründung, dann würden sie niemals richtig Deutsch lernen. Als ich einmal eine polnische Mitschülerin mit nach Hause brachte und meine Oma mit ihr Polnisch sprach, hat mich das total überrascht. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass sie fließend Polnisch spricht. Das wurde bei uns zu Hause nie thematisiert. Im Nachkriegsdeutschland hat man Polacken ja noch auf Kakerlaken gereimt.
Was hat Ihr Vater Ihnen von seiner Kultur, seiner Heimat erzählt?
Bei uns in der Wohnung hing eine Landkarte von Indien. Die einzigen Karten, die man von dem Land seinerzeit bekam, waren Teekarten. Darauf war verzeichnet, wo welche Teesorte angebaut wurde. Auf der Karte stand „Tee aus Indien und Ceylon“. Damals hieß das heutige Sri Lanka ja noch Ceylon. Das war der alte Kolonialname. Anhand der Karte hatte ich verinnerlicht, wo welche Orte in Indien lagen. Mein Vater hat sich sehr für Politik interessiert, deshalb wusste ich als Kind, dass Indira Gandhi Premierministerin von Indien war, aber nicht, wer deutscher Kanzler war. Und es gab natürlich all die Geschichten über Gandhi selbst und Nehru und den Unabhängigkeitskampf gegen die Briten. Mein Vater ist noch im Raj geboren. Indien war damals britische Kolonie. Er hat die Unabhängigkeit 1947 als Jugendlicher miterlebt.
Wo sind Sie zur Schule gegangen?
Ich bin auf die Höhenschule gegangen. Ich erinnere mich, dass aus meiner Grundschulklasse damals neben mir nur noch ein weiteres Kind eine Gymnasialempfehlung bekommen hat, von knapp 30 Kindern. Das war bei meinem Sohn, der auf der Sonnenschule war, 30 Jahre später übrigens ähnlich. Trotz dieser doch sehr klaren Vorstellung davon, was unser Platz in der Gesellschaft war, war meine Grundschullehrerin, Frau Vink, eine wirklich tolle Pädagogin. Sie war damals kurz vor der Rente und wahnsinnig streng und gleichzeitig wahnsinnig passioniert. Sie hat Förderunterricht nicht nur für leistungsschwache, sondern auch für besonders leistungsstarke Kinder angeboten. Und sie war ein sehr literarischer Mensch, deshalb ging es im Deutschunterricht hauptsächlich darum, Aufsätze zu schreiben und schöne Bilder und Beschreibungen zu finden. Das hat mich sehr geprägt. Das Lessing-Gymnasium war dann ein regelrechter Schock. Es war eine sehr politische Schule, was toll war, aber alle musischen Fächer wurden ziemlich vernachlässigt. Dabei hatten wir den Künstler Bert Gerresheim als Kunstlehrer, aber er war nahezu nie da.
Welche Rolle hatten Sie innerhalb des Klassenverbandes?
Ich bin ein Jahr zu früh eingeschult worden und hatte immer sehr gute Noten, was keine gute Kombination war. Dazu kam, dass ich wegen des Altersunterschieds viele soziale Codes nicht verstanden habe. Meine Mutter dachte damals, dass Fernsehen schlecht für Kinder ist, also kannte ich die Serien nicht, die alle schauten. Was es mir zusätzlich erschwerte, war die Tatsache, dass ich keine klare Herkunft hatte. Anders als jene Kinder, deren Eltern beide Italiener oder beide Türken waren, gehörte ich weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe. Ich wurde nicht gemobbt, ich war eher die merkwürdige Mithu, bei der viele nicht so richtig wussten, wie sie mit ihr umgehen sollten. Das hat sich schlagartig verändert, als ich an die Uni wechselte.
Was hatten Sie als Jugendliche für eine Idee von Ihrem Leben?
Als Kind wollte ich Romane schreiben, weil ich Enid Blyton toll fand. In ihren Büchern kamen immer Kids vor, die geschrieben haben. Also habe ich das auch gemacht. Ich habe noch immer die Romananfänge von damals in einer Umzugskiste unter dem Bett. Es gab ja ohnehin nicht viele Berufe, die für Mädchen zu der Zeit denkbar waren. Aber Schriftstellerin gehörte dazu. Während der Zeit am Gymnasium verlor ich jedoch den Glauben daran, dass das möglich sein könnte. Ich dachte, nichts von dem, was ich der Welt anbieten kann, ist für sie relevant. Dieses Gefühl blieb auch an der Uni. Zumal uns immer gesagt wurde: „Studiert, so lange ihr könnt, weiter. Ihr werdet als Geisteswissenschaftler eh keinen Beruf finden und müsst Taxi fahren.“
Aus Ihnen hätte auch problemlos eine Naturwissenschaftlerin werden können. Am Gymnasium entwickelten Sie ein ausgeprägtes Faible für Mathematik.
Mathe habe ich immer schon geliebt. Die Aufgaben zu lösen, ist geradezu körperlich befriedigend. Alles macht Sinn. In der Oberstufe wählte ich das Fach deshalb als Leistungskurs. Mein LK-Lehrer kam damals in der ersten Stunde herein und sagte: „Ich sehe, hier sitzen zwei Mädchen im Kurs. Das wird sich bis Ende des Schuljahrs ändern.“ Er hat einen regelrechten psychologischen Kleinkrieg gegen uns geführt. Ich bekam Klausuren zurück: 0 Fehler, Note: 3. Ich habe einen anderen Lehrer gefragt, wie das denn sein könnte. Er meinte nur: „Ach, Mathe ist so ein Fach, in dem alles Ermessenssache ist.“ So ein Blödsinn! Ich glaube, wenn ich zehn Jahre später zur Schule gegangen wäre, hätte ich Mathe studiert und wäre eine sehr glückliche Mathematikerin geworden. So bin ich eine noch viel glücklichere Autorin und Schriftstellerin.
Wie sind Sie denn letzten Endes dahin gekommen, wo Sie jetzt sind? Was haben Sie studiert?
Ich habe viele verschiedene Studiengänge ausprobiert. Poetik und Ästhetik an der Kunstakademie, Journalistik in Dortmund, ich habe die ganze philosophische Fakultät in Düsseldorf hoch und runter studiert. Irgendwann habe ich an der Universität Duisburg-Essen den Studiengang Literaturvermittlung/Medienpraxis gefunden. Der wurde damals von Jürgen Manthey geleitet, einer journalistischen Lichtgestalt. Er hat erwartet, dass wir alle Feuilletons gelesen hatten, wenn wir in sein Seminar kamen. War das nicht der Fall, ist er einfach gegangen. Also sind nur sehr wenige Studierende in seinen Seminaren geblieben. Wir haben gearbeitet bis zum Umfallen. Professor Manthey hat mich irgendwann in sein Büro bestellt und gesagt: „Bringen Sie mal Texte mit.“ Ich habe ihm also ein paar Kurzgeschichten von mir gezeigt. Auf seine Frage, was ich gerne beruflich machen würde, antwortete ich: „Fürs Radio arbeiten.“ Bis dahin hatte ich nur für die Düsseldorfer Stadtzeitung Terz geschrieben. Manthey hat daraufhin eine Freundin beim Deutschlandfunk angerufen. So habe ich meinen ersten Fünfminüter fürs Radio gemacht. Jürgen Manthey habe ich es jedenfalls zu verdanken, dass ich von meinem Schreiben leben kann. Ohne ihn wäre ich niemals in die Medienbranche hineingekommen. Ich mit meinem Oberbilk-Hintergrund wusste ja nicht einmal, wie man sich bewirbt.
Bevor Sie 2006 nach Oberbilk zurückgekehrt sind, haben Sie sieben Jahre in einer WG in Flehe gewohnt. Wie haben die Menschen dort auf Sie reagiert?
In Flehe habe ich mich immer als Fremdkörper gefühlt. Es gab viele Nachbarn, die mich nicht gegrüßt haben. Also explizit mich nicht, während sie meine weißen Mitbewohner*innen durchaus gegrüßt haben. Außerhalb von Oberbilk werde ich häufig für eine Muslima gehalten. Da fallen dann Sprüche wie „Mutig von dir, dass du kein Kopftuch trägst und als muslimische Frau über die Vulva schreibst“. So etwas passiert mir in Oberbilk nicht. Vielleicht, weil es genügend kulturelles Wissen gibt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fühle ich mich im Stadtteil angenommen wie nirgends sonst. Wenn ich auf die Straße gehe, freuen sich alle, mich zu sehen. Das war an den anderen Orten, an denen ich gewohnt habe, anders.
Wie erleben Sie das Zusammenleben der Menschen in Oberbilk?
Es gab und gibt im Stadtteil immer wieder Bestrebungen, die Nachbarschaft zusammenzubringen. Das ist toll, zumal ich mich an ein ähnliches Gefühl von Lokalstolz in meiner Kindheit nicht erinnern kann. Es herrscht eine ausgeprägte Freundlichkeit und Wärme auf der Straße, aber trotzdem bleiben alle doch sehr in ihren Blasen. Mein Sohn hat, wie schon erwähnt, bevor er aufs Goethe-Gymnasium wechselte, die Sonnenschule in Oberbilk besucht. Mit den Eltern seiner Mitschüler*innen hatte ich fast nichts zu tun. Die Kinder haben sich auch überraschend selten gegenseitig zu Hause besucht, sondern hauptsächlich draußen miteinander gespielt. Das erinnere ich aus meiner Kindheit ähnlich. Die Communitys blieben unter sich. Richtig viel Vermischung gab es nicht. Bis heute empfinde ich das als sehr spezifisch für das Zusammenleben in Oberbilk. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen: Der beste Freund meines Sohnes stammt aus einer mazedonischen Roma-Familie. Die haben ihn extrem herzlich aufgenommen.
Sie haben eingangs erwähnt, dass Oberbilk während Ihrer Kindheit über wenig Aufenthaltsqualität verfügte. Wie empfinden Sie das heute? Und welche Orte schätzen Sie besonders?
Ich liebe ganz viele Orte in Oberbilk. Neben dem Volksgarten und der Flügelstraße, auf der übrigens früher meine Oma gewohnt hat, mag ich die Kölner Straße sehr. Die ist mittlerweile ja eher kiezig-abgeranzt. Früher war sie kleinbürgerlich-spießig. Ich erinnere mich, dass mein Vater, als ich ein Kind war, immer versucht hat, dort Basmati-Reis zu bekommen. Das war damals noch unmöglich, selbst in Oberbilk. Er musste also mit Uncle Ben’s Parboiled-Reis vorliebnehmen.
Bis in die 2000er Jahre gab es am Oberbilker Markt noch die Karstadt-Filiale. Die hatten drei oder vier Drehregale mit Büchern. In denen fanden sich neben absolutem Schrott auch viele feministische Klassiker, vor allem aus dem Science-Fiction-Bereich. Die Person, die das Programm zusammengestellt hat, muss Feminist*in gewesen sein! Viele hervorragende Bücher, die immer noch bei mir im Regal stehen, habe ich bei Karstadt am Oberbilker Markt gekauft. Das Kaufhaus war damals sozusagen der einzige Buchladen in Oberbilk.
Was mag ich sonst noch? Den Bioladen Ökologische Marktwirtschaft auf der Heerstraße, die eine tolle Auswahl haben und ihr Geschäft mit so viel Liebe betreiben. Den kleinen Platz gegenüber von der Shell-Tankstelle, auf dem im Frühjahr immer die japanischen Kirschen blühen. Den Souterrain-Schuster Der schnelle Jo auf der Kruppstraße, der war schon in meiner Kindheit da. Und es ist auch noch derselbe Betreiber. Inzwischen hat er aber nur noch wenige Stunden am Tag geöffnet, um mehr Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen. Es ist ein warmes Gefühl, das etwas geblieben ist, obwohl sich insgesamt viel verändert hat.
Die Veränderungen im Stadtteil haben stark mit dem sogenannten Strukturwandel, also dem Abzug der Industrie, zu tun. Von 130 Jahren Oberbilker Industriegeschichte gibt es heute fast keine Spuren mehr. Wie denken Sie darüber?
Während meiner Kindheit wohnten wir, ich erzählte es ja schon, auf der Sonnenstraße. Die endete damals dort, wo heute der 2004 eingeweihte Sonnenpark beginnt. An der Stelle war früher eine Mauer. Dahinter lagen die Fabriken. Für uns Kinder war das eine geheime Welt. Ich finde es tragisch, dass die Fabriken alle abgerissen worden sind. Vor allem die Vereinigten Kesselwerke vermisse ich sehr. Wenn ich aus den Ferien kam, war der Schornstein der VKW immer das Signal, dass ich zu Hause bin. Man hätte diese Bauten ja auch ins Stadtbild integrieren können. Dass das nicht passiert ist, ist meines Erachtens eine verpasste Chance.
Eine geheime Welt ist für viele auch das Bahndamm-Bordell. Eine Art paralleles Universum, das völlig losgelöst vom Stadtteil existiert.
Ich würde mir eine stärkere Einbindung des Rotlichtviertels in den Stadtteil wünschen. Der Bahndamm liegt von unserer Wohnung gerade mal zwei Minuten entfernt. Dennoch bekommen wir im Alltag nichts davon mit. In den neunziger Jahren in New York war es zum Beispiel so, dass die Leute, die im Bordell gearbeitet haben, auch im Stadtbild zu sehen waren. Das Ganze war Teil des Alltags und nicht an den Rand gedrängt und versteckt.
Was glauben Sie, wie wird sich Oberbilk in Zukunft entwickeln?
Schwer zu sagen. Die großen Bauprojekte machen mir schon Angst. Wie viele Menschen wünsche auch ich mir, dass etwas von dem, was in der Vergangenheit da war, auch in Zukunft noch sichtbar und spürbar sein wird. Die Fabriken meiner Kindheit geistern nur noch durch die Straßennamen: Stahlstraße, Eisenstraße, Hüttenstraße, Stahlwerkstraße. Ich war Anfang der neunziger Jahre dabei, als das Lesben- und Schwulenzentrum „Café Rosa“ am Oberbilker Markt geräumt wurde. Das Haus ist im Anschluss abgerissen und durch das Internationale Handelszentrum ersetzt worden. Die Vereinigten Kesselwerke sind später ebenfalls verschwunden. An ihrer Stelle entstand das Land- und Amtsgericht. Als das nach Oberbilk zog, hat man auch schon damit gerechnet, dass sich das Viertel stark verändern würde. Bis heute ist Oberbilk aber verblüffend renitent. Ich hoffe, dass wir das auch weiterhin bleiben.
______________________________________________________________________________________________________________________
 Über Mithu Sanyal
Über Mithu Sanyal
Mithu Sanyal wurde 1971 in Düsseldorf geboren. Nach dem Abitur studierte sie deutsche und englische Literatur an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und promovierte über die Kulturgeschichte des weiblichen Genitals. Aus ihrer Doktorarbeit entstand 2009 das Buch „Vulva. Die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts“, das bis heute als Pionierarbeit zu diesem Thema gilt. 2016 folgte ihr zweites Buch „Vergewaltigung. Aspekte eines Verbrechens“, 2021 ihr erster Roman mit dem Titel „Identitti“. Als Journalistin arbeitet Sanyal für zahlreiche Medien, darunter WDR, SWR, Deutschlandfunk, DER SPIEGEL, The Guardian, taz und Missy Magazine.
Das Interview mit Mithu Sanyal entstammt dem Buch „Oberbilk. Hinterm Bahnhof“ von Alexandra Wehrmann und Markus Luigs. Die Journalistin und der Fotograf haben dafür 38 sehr unterschiedliche Menschen aus dem Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk in Wort und Bild porträtiert. Das Buch kostet 25 Euro und ist unter duesseldorferperlen.de zu bestellen.
Wir danken den Herausgeber:innen für die Abdruckrechte.