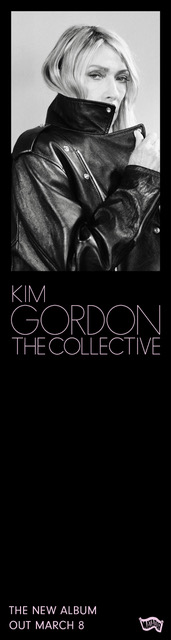Gorillaz / Shame / The Strokes
 Gorillaz
Gorillaz
“Cracker Island”
(Parlophone)
Aus irgendeinem Grund funktioniert mein Kopf so, dass ich ständig in irgendwelchen Phasen bin und mich darin dann mit hauptsächlich einer/m Künstler:in/Genre beschäftige.
Beispiel: Letztens war ich ziemlich lange von Bob Dylans Bootleg Series besessen, hab danach für eine Woche fast nur Indie-Rock aus den 90ern gehört, bis ich auch davon genug hatte und wieder mal in eine Wu-Tang-Phase reingerutscht bin. Kann sehr nice sein, so obsessiv in etwas abzutauchen, ist in seltenen Fällen aber auch kontraproduktiv – weil ich mich dann auch kaum für Dinge begeistern kann, die so gar nichts mit meiner aktuellen Passion zu tun haben (außer natürlich für Sachen, über die ich schreibe; das ist was anderes). So war ich wohl schon als Kind, auch wenn’s damals wohl nicht Bob Dylan und der Wu-Tang Clan waren, sondern Star Wars und Herr der Ringe.
 Mit anderen Worten: Manchmal wär ich gerne mehr wie Damon Albarn. Wie kein anderer repräsentiert er für mich das ständige Kombinieren von verschiedenen Ästhetiken, die ihn gerade alle gleichzeitig begeistern. Das sieht man nicht nur an der Bandbreite an Features (Albarn ist wahrscheinlich der vielseitigste Kollaborateur der modernen Popgeschichte) und Genres (in den 2000ern war er ausgesprochen einflussreich für das Zusammenführen verschiedener Stilrichtungen) auf den Gorillaz Alben, sondern auch in der “Making-Of”-Dokumentation zum 2010er Meisterwerk “Plastic Beach”: In einer Aufnahme sitzt Albarn da noch als klassischer Britpop-Boy mit Blazer und der passender Frisur, trägt jedoch schon in der nächsten Szene wieder Jogginghose, Baseballcap und Goldkette. Ja, man darf alles gleichzeitig sein.
Mit anderen Worten: Manchmal wär ich gerne mehr wie Damon Albarn. Wie kein anderer repräsentiert er für mich das ständige Kombinieren von verschiedenen Ästhetiken, die ihn gerade alle gleichzeitig begeistern. Das sieht man nicht nur an der Bandbreite an Features (Albarn ist wahrscheinlich der vielseitigste Kollaborateur der modernen Popgeschichte) und Genres (in den 2000ern war er ausgesprochen einflussreich für das Zusammenführen verschiedener Stilrichtungen) auf den Gorillaz Alben, sondern auch in der “Making-Of”-Dokumentation zum 2010er Meisterwerk “Plastic Beach”: In einer Aufnahme sitzt Albarn da noch als klassischer Britpop-Boy mit Blazer und der passender Frisur, trägt jedoch schon in der nächsten Szene wieder Jogginghose, Baseballcap und Goldkette. Ja, man darf alles gleichzeitig sein.
So herausragend wie “Plastic Beach” ist die neue Platte “Cracker Island” leider nicht. Dafür kommt im Folgenden zu oft das Wort ABER: Der Opener fetzt, ABER Star-Bassist Thundercat ist viel zu leise abgemischt; “Oil” ist definitiv stabil, ABER Steve Nicks wäre auf einer anderen Art von Song interessanter gewesen; “The Tired Influencer” klingt ganz cool, ABER der Titel ist irgendwie cringe.
Ein wirkliches Konzept wird auf dem Album auch nicht deutlich, jedenfalls fühlt sich die “Cracker Island” weniger wie ein echter Ort an als der “Plastic Beach”. Ist bestimmt die Schuld von dem neuen Co-Produzenten Greg Kurstin, diesem Popschwein.
Shame
“Food for Worms”
(Dead Oceans)
Ist ganz unironisch gemeint: Endlich mal wieder Mitgröl-Refrains mit übergroßen Gruppenvocals. Können ja nur noch die wenigsten, ohne dass es peinlich klingt. Zu oft wirkt’s aufgeblasen, wie eine schlechte Karikatur oder halt wie die Toten Hosen. Aber nicht bei Shame, die in fast jedem Song auf ihrem Drittwerk “Food for Worms” damit durchkommen. Das von Existenzangst und innerlicher Wut geprägte, etwas zu verkopfte Gefühl von Dringlichkeit auf dem Vorgänger “Drunk Tank Pink” (zu viele Momente fühlten sich verkrampft an; der neue Fokus auf Komplexität à la Talking Heads hat damals nur so halb funktioniert) macht hier wieder Platz für Faust-in-die-Luft-Songs wie “All The People” – ein Albumcloser, der sich auch wie einer anfühlt. Irgendwann singen darin alle fünf Bandmitglieder zusammen. Keiner trifft so wirklich die Töne, aber kackegal. Das muss so.
Ein straighter Schritt zurück zu der pubertären Raudi-Energie ihres Debüts “Songs of Praise” (2018), mit der sie sich damals von artverwandten Bands wie IDLES und Fontaines D.C. unterschieden haben, ist “Food for Worms” jedoch keineswegs. Obwohl die Platte wieder eine extrovertierte Grundstimmung als “Drunk Tank Pink” hat, ist die Reife dieser Lieder dafür schlichtweg zu spürbar. Beispielsong “Orchid”: Hat was folkiges, was leicht proggiges, was supertolles. Frontmann Charlie Steen nennt das Album den “Lamborghini unter den Shame-Platten”. Lass ich durchgehen.
Der beste Song? “Adderall”. Macht mein Herz so schön warm, aus offensichtlichen Gründen. Sie ist zwar alles andere als auffällig, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass Indie-Heldin Phoebe Bridgers hier mitsingt. Einfach weil’s Phoebe Bridgers ist.
Und weil “Food for Worms” als wertschätzendes Album über Freundschaft konzipiert wurde, muss diese Rezension jetzt hiermit beendet werden: Zum ersten Mal hab ich die Platte in einer Woche gehört, in der ich jeden Tag was mit meinem guten Freund Wölko gemacht hab (unter anderen haben wir den großartigen Film “The Banshees of Inisherin” geguckt, wo wir gerade beim Thema Freundschaft sind). Was ich damit sagen will: Shoutout Wölko.
The Strokes
“The Singles Volume 1”
(RCA)
Klar, Geldmacherei. Wir alle kennen die Songs schon und können auf eine hübsch zurechtgemachte Vinyl-Box für 125€ (ZEHN SINGLES FÜR 125€?!) verzichten. Aber weil kaum etwas cooler ist als The Strokes – wer The Libertines sagt, soll bitte gehen – und weil man sich den Bumms ja nicht kaufen muss, um ihn als Anlass für eine Neubetrachtung dieser Songs zu nehmen, gibt’s jetzt noch ein Ranking der zehn ersten Strokes-Singles. Gern geschehen. Da es sich bei den B-Seiten teilweise um Demos und Live-Aufnahmen handelt, werden hier allerdings nur die A-Seiten berücksichtigt… Also: Let’s go. Party.
10. “Juicebox”
Ist gar nicht negativ gemeint, doch die Liste von Momenten in der Strokes-Diskographie, die scheinbar schamlos von Songs anderer Künstler:innen, sagen wir, geborgt wurden, ist zumindest für eine Indie-Band ihrer Sorte ungewöhnlich lang. Die offensichtlichen Beispiele sind den meisten Fans bekannt: Während das “Last Nite”-Intro an den Anfang von Tom Pettys “American Girl” erinnert, hat der Refrain von “Bad Decisions” fast die gleiche Gesangsmelodie wie “Dancing With Myself” von Billy Idol. In beiden Fällen funktioniert diese sehr direkte Form von Hommage ziemlich gut. Das Bassriff in “Juicebox” hingegen ähnelt für meinen Geschmack etwas zu sehr dem “Peter Gunn Theme”. Naja, die Energie steckt trotzdem an. Und im letzten Drittel kommt das besagte Bassriff auch nicht mehr zurück, glücklicherweise.
9. “The Modern Age (Rough Trade Version)”
Nur um das klarzustellen: Würde es sich hierbei nicht um die etwas hektische Pre-“Is This It”-Aufnahme von “The Modern Age” handeln, sondern um die lässige (und deshalb sehr viel bessere) Albumversion, wäre dieser Song wahrscheinlich weiter oben gelandet. Ganz sicher sogar.
8. “Heart In a Cage”
Nur einmal hab ich The Strokes bisher live gesehen: 2019 auf dem All Points East Festival in London, und die Band hat mit “Heart In a Cage” gestartet; einer der besten Konzertmomente meines Lebens. Fast 40.000 Zuschauer – hauptsächlich betrunkene Briten, versteht sich – sind von einer Sekunde auf die andere in pure Ekstase verfallen und den gesamten Auftritt über in diesem Zustand geblieben. Niemanden schien so wirklich zu interessieren, dass es technische Probleme gab, der Sound generell ziemlich miserabel war und Frontmann Julian Casablancas immer wieder seine Lyrics vergaß. Letzteres war irgendwie sogar sympathisch.
7. “Last Nite”
Ich weiß, ich weiß. Du findest wahrscheinlich, dass dieser swingende Indie-Klassiker viel weiter oben sein müsste. Don’t hate me, aber für mich war “Last Nite” immer schon einer der verhältnisweise schwächeren Songs auf “Is This It”. Wie gesagt, verhältnisweise. Ist natürlich ein hervorragendes Lied, aber nicht auf ganz so großartige Weise auskomponiert und Zahnrad-mäßig arrangiert wie die anderen Songs auf dem Album. Für mich ist es mit “Last Nite” wie mit Kendrick Lamars “Money Trees” – ein Track, den viele Fans als ihren Favoriten nennen, während er für mich zu den eher unwichtigeren Stücken auf “good kid, m.A.A.d. city” gehört (nochmal: Don’t hate me).
6. “The End Has No End”
Zu sagen, dass man “Room on Fire” besser als “Is This It” findet, ist mittlerweile keine unpopular opinion mehr. Ich bin mir diesbezüglich immer noch nicht zu 100% sicher, aber jedenfalls machen häufig unerwähnte Highlights wie “The End Has No End” das Strokes- Zweitwerk zu einem mindestens ebenso großen Genuss wie dessen Vorgänger. Außerdem schienen viele Leute damals übersehen zu haben, dass die Gruppe auf “Room on Fire” sehr wohl in neue Richtungen gegangen ist und nicht einfach nur die Formel von “Is This It” wiederholt hat. Ungewöhnlichere Songstrukturen, eine neue Vielfalt an Gitarrensounds, mehr Groove. (Dazu noch die Reggae-Einflüsse in “Automatic Spot” und die Motown- esque Ballade “Under Control”; überragend.)
5. “You Only Live Once”
“First Impressions of Earth”, das Fanbase-spaltende Drittwerk der Strokes, ist zwar offensichtlich nicht auf dem gleichen Level wie “Is This It” und Room on Fire”, wurde in meinen Augen jedoch immer schon unfair behandelt. Klar, die zweite Albumhäfte ist trotz Highlights wie “Ize of the World” deutlich schwächer als die erste, der unaufdringliche Swag der Gruppe ist etwas verloren gegangen und die Produktion ist an manchen Stellen etwas over the top, ABER: Die Momente auf “First Impressions of Earth”, die funktionieren, sind fantastisch. Vor allem der Opener “You Only Live Once” gibt mir das Gefühl, als könnte ich jedes Problem dieser Welt von meinen Schultern schnipsen.
4. “Someday”
Die Frage, was genau Coolness ist, gehört zu den Lieblingsgesprächsthemen von mir und meinem alten Herrn – wahrscheinlich, weil wir so herrlich verschiedener Meinung sind. Und wenn uns dann irgendwann die Argumente ausgehen, zählen wir einfach Leute auf, die wir cool finden. Er sagt immer zuerst Adriano Celentano, ich sag immer zuerst The Strokes. Jedenfalls: “Someday” ist ein guter Song.
3. “Reptilia”
Immer wenn ich “Reptilia” höre, macht mein Gesicht ähnliche Sachen wie das von Frontmann Julian Casablancas im dazugehörigen Musikvideo.
2. “12:51”
Meistens wird in Gesprächen über “12:51” nur der Synth-artige Gitarrensound von Nick Valensi erwähnt, doch das eigentliche Highlight sind die Lyrics: “We could go and get forties/Fuck going to that party/Oh, really, your folks are away now?/Alright, let’s go, you convinced me” ist vielleicht die beste Zeile, die Julian Casablancas je geschrieben hat.
1. “Hard To Explain”
Klar, man kann die Musik der Strokes einfach nur wegen ihrer lässigen, ultra-coolen Grundstimmung toll finden. Völlig okay. Doch es steckt so viel mehr in diesen Songs – ich mein rein kompositorisch, so besser-als-Mozart-mäßig –, von denen “Hard To Explain” wohl der zeitloseste ist. Man hört, dass Hauptsongwriter Julian Casablancas mindestens ein bisschen Ahnung von Musiktheorie hat und sich ganz genau überlegt hat, WANN und WIE sich WELCHES Instrument WO hinbewegt. Er mag das Genie der Band sein, doch so perfekt spielen können das Ganze nur Nikolai Fraiture, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr. und Nick Valensi, die laut eigenen Angaben sehr lange daran arbeiten, diese unaufdringlich komplexen Songs spontan wirken zu lassen. Am Ende klingt’s dann wie fünf Bekiffte, die tight klingen wollen. Oder andersrum. Keine Ahnung. It’s hard to explain.
XXX