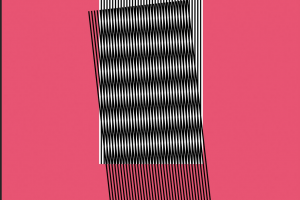Britney Spears “Glory”
 Britney Spears
Britney Spears
Glory
(RCS/Sony)
Ich möchte voranschicken, dass es keineswegs meine Absicht ist, das neue Album von Britney Spears zu verreißen oder mich darüber lustig zu machen – das wäre die einfache, billige Masche. Es ist eher so, dass mich „Glory“ unendlich deprimiert, naja, unendlich ist übertrieben, aber doch sehr deprimiert. Das fängt schon mit dem Albumtitel an: „GLORY“ – kann es noch trauriger werden? „Glory“, das hätte zu The Jacksons in den frühen 1980ern gepasst, zwischen „Triumph“ und „Victory“. Aber zu Britney? Wahrscheinlich ist sie vom Showgirl-Dasein in Las Vegas („Piece of Me“ heißt ihre Show, die sie dort seit drei Jahren aufführt) so zermürbt, dass sie die Titelvorschläge ihrer Marketingabteilung einfach müde durchwinkt, „okay, Glory, warum nicht? Auch nicht schlimmer als ‚Circus‘ oder ‚Femme Fatale‘“.
Ein bisschen müde klingt auch das ganze Album, das aber, paradox enough, nicht weniger als siebzehn (siebzehn!) Songs featuret, von denen allerdings nur wenige im Gedächtnis bleiben. Am ehesten noch das melancholische „Just Luv Me“, in dem Britneys Stimme ganz klar und präsent wirkt, aber auch verzweifelt, zerbrechlich, bittend. Berührend ohne Kitsch.
Die Musik ist auf „Glory“ ist superslick produziert (u.a. von Burns, Warren Felder, Alex Nice), teils party-pumpend, insgesamt jedoch ziemlich konturlos. Halt so, wie Chartsmusik heute zu klingen hat: Es gibt Electroswing-Einspieler (urgs), Doo-Wop-Gesang, Reggae (bei „Slumber Party“) und sehr viel poppigen R’n’B mit verschleppten Beats. Mit „Glory“ zeigt Britney zwar, dass sie – nach all dem Scheiß – noch mithalten kann, aber mehr auch nicht. Besonders evident wurde das bei den unlängst gelaufenen Video-Music-Awards, als Beyoncé so viel Glam und political awareness verbreitete (eigentlich waren es ihre, Beyoncés Awards), und Rihanna ihre fröhlich-pinkfarbene Parade abzog, dass für Britney nur Höflichkeitsapplaus übrig blieb. Die Show und die Statements liefern längst andere.
„Glory“ dreht sich von vorn bis hinten um Sex, was auf der bereits erwähnten Langstrecke zäh und (sorry) abgelutscht wirkt. Die Songtitel spielen entweder subtil oder hammerdeutlich auf das Thema Number One an („Clumsy“, „Slumber Party“, „Private Show“, „Do You Wanna Come Over?“); das Video zu „Make Me“, gedreht von David LaChapelle, kommt über die cheapo Ästhetik eines Cola-Light-Werbeclips nicht raus. Britney in hässlichen Spitzenhöschen und –bodys und Finger im Mund, oh dear, wäre es anno 2016 nicht mal an der Zeit für neue Sexiness-Modelle? Die vom Leben gebeutelte Britney verlässt sich auf Nummer-Sicher-Symbolik, und ich kann es ihr nicht mal verübeln. Ist doch alles anstrengend genug, und Spitzenhöschen in schwarz oder weiß KAPIEREN die Leute wenigstens. Ach, deprimierend ist das, erwähnte ich ja schon.
Interessanter ist die „Carpool Karaoke“-Folge mit Britney, wo sie James Corden eröffnet, dass sie gern noch drei Kinder hätte („you mean three MORE kids, so you’d have five???“), aber das „men-thing“ nicht mehr mitmachen will. DAS wäre doch mal ein interessantes Thema für ein Album, nicht immer nur dieses Spitzenhöschen-SEX-Ding, gähn. Vom Album ziehe ich mir „If I’m Dancing“ und „Just Like Me“ und bin raus.