„Die Schlange ist der Anti-Ort zur Tanzfläche“

Christine Preiser & Jan-Michael Kühn im Gespräch über subkulturelles Nachtleben zwischen sozialen Ungleichheiten und ökonomischen Interessen (Photo: Thomas Venker)
Der eintägige Kongress “Electronic Body Music. Ordnung in und als Bewegung” stellte am 18. Februar im Dortmunder Tanzcafé Oma Doris soziologische sowie kultur- und sozialanthropologische Perspektivnahmen auf die Szene elektronischer Tanzmusik öffentlich zur Diskussion. Thomas Venker nutze die Gelegenheit zu einem Gespräch mit den Vortragenden Christine Preiser und Jan-Michael Kühn über Szenegefüge und soziale Ungleichheiten.
Christine, Jan-Michael, Nachtleben verbinden die meisten mit Eskapismus und Hedonismus – wie fühlt es sich an, sich dem Feld wissenschaftlich zu nähern? Gab es da einen anfänglichen Moment des Haderns?
Christine Preiser: Als ich anfing, mich mit Türstehern zu beschäftigen, wunderte ich mich noch, dass diese selbst nicht am Nachtleben teilnehmen und ausgehen. Nach anderthalb Jahren Feldforschung habe ich es verstanden: Wenn man auf der nüchternen Seite des Nachtleben steht, nimmt man den Eskapismus anders wahr. Ich brauchte eine Weile, um mich von diesen Erfahrungen zu erholen und Auszeit und Sich-Gehenlassen wieder als solches genießen zu können und eben nicht als Soziologin wahrzunehmen, die viele betrunkene Menschen nüchtern gesehen hat.
Jan-Michael Kühn: Für mich war das am Anfang ein praktisches Problem. Ich habe Soziologie studiert und musste eine Abschlussarbeit machen. Und da mir bewusst war, dass ich ein interessantes Thema brauchte, da ich es sonst nicht schaffen würde, lag es nahe, etwas über die Musikszene zu machen, in der ich eh aktiv war. Ich hab mir dann das Thema “Musikmachen in der Homerecording-Szene” rausgesucht.
Berührungsängste zwischen Wissenschaft und Szene hatte ich nie, da ich mich als Ethnograph eh immer zwischen den Stühlen befinde. Aber was mir stark auffiel, war die Ablehnung von Leuten aus der Szene gegenüber Leuten, die sich wissenschaftlich auftun und die Magie der Szene gegen die Legitimation in der bürgerlichen Wissenschaft eintauschen.
Christine Preiser: Ich erlebte eine Aufgeschlossenheit und Wertschätzung dafür, dass sich jemand für die Welt der Türsteher interessierte, der es nicht gleich um das Wertende und Diskriminierende ging. Das Wissenschaftliche erleichterte den Feldzugang. Wenn ich gesagt hätte, ich sei Journalist, wär das bestimmt anders gewesen.
Jan-Michael Kühn: Solche Erlebnisse hatte ich bei den Musikproduzenten auch. Die sitzen ja sonst in ihrem Studio und keiner fragt sie, was sie da genau machen. Auch wenn ich die dümmsten Fragen stellte, haben sie sich gefreut, das alles mal erzählen zu dürfen.
Es handelte sich um Hobby-Musikproduzenten?
Jan-Michael Kühn: Nicht nur. Da waren auch welche dabei, die davon leben und jeden Monat zwei, drei Tracks raushauen und als DJ touren.
Jan-Michael, du sprichst von der post-traditionellen Vergemeinschaftung, die es zwischen Szene, Szenewirtschaft und Subkultur zu diagnostizieren gilt – aufbauend auf die theoretischen Ausführungen von Ronald Hitzler. Das wirft zwei Fragen auf, die sich eventuell gegenseitig auflösen:
1. Was ist die traditionelle Form der Vergemeinschaftung?
2. Auf welcher Grundhypothese fundiert diese post-traditionelle Auftrennung in drei Begriffe? Zumindest die nicht Gleichsetzung von Szene und Subkultur erscheint mir auffällig und hinterfragenswert.
Jan-Michael Kühn: Die traditionelle Form der Vergemeinschaftung ist etwas, was heutzutage immer mehr abgelöst wird. Das sind Sozialformen wie Nachbarschaften, Familienstände und Klassen, wo durch Herkunft bestimmt wird, was man für Chancen im Leben hat, was man wählen wird und welchen Sinn man im Leben sucht. Alles, was stark festgelegt ist und einem wenig Spielräume zum bewegen lässt. Das waren bis zum Anfang der Industrialisierung die dominanten Sozialformen.
Mit derr Demokratisierung, Massenproduktion und Berufsvielfalt hat sich das verändert, als der Sektor der Freizeit aufkam und man sich in freieren Formen zu bewegen begann. Frei heißt, dass man immer mehr selbst nach seinen ästhetischen Interessen wählt, was für einen die relevanten Dinge im Leben sind. Entsprechend bewegt man sich heutzutage mehr in Szenen oder auch z.B. in Bürgerinitiativen.
Natürlich bilden sich auch im posttraditionellen Zustand Traditionen heraus, die Standards aufweisen. Die funktionieren aber in einem anderen Modus. Bei Techno beispielsweise gibt es im Zentrum der Szene ganz starke Institutionen, die das Ganze sehr ähnlich halten: Das sind unter anderem Erlebnisstrukturen mit sakralem Charakter für die teilnehmenden Leute, die verteidigt werden.
Von den vielen Formen posttraditioneller Vergemeinschaftung, die es gibt, ist die Szene eine prototpische. Szenen zeichnen sich dadurch aus, dass es ein Thema gibt: Mode, oder Freizeitbeschäftigungen wie Gaming, Klettern, oder eben Techno. Etwas, wo die Leute sagen, dass es ihr Ding ist und das sie mit Freunden leidenschaftlich angetrieben betreiben. Bei der Szenewirtschaft ist dann die These, dass es nicht nur um Vergemeinschaftung geht, sondern auch um Aspekte wie Wirtschaft und Arbeit bedeutend sind. Damit verbunden ist die Idee, dass eine neue Form von ästhetischer Subkultur entstanden ist.
In diesem Spannungsfeld aus Möglichkeiten, Freiheiten, Abhängigkeiten und Widersprüchen bewegen wir uns.
Und was trennt denn die Szene von der Subkultur?
Christine Preiser: Szene ist der leidenschaftlich getriebene Kern, wo die persönliche Bindung zwischen den Akteuren die Produktion von Musik und Style voranbringt. Die Subkultur ist die größere Einheit.
In den Clubs, wo ich war, gab es Leute, die sich durch Kleidung und Habitus zu einer gewissen Subkultur positionieren, die aber nicht zwangsläufig aktiv produzieren und an Knotenpunkten teilnehmen.
Szene als kreativer Nukleus der Subkultur sozusagen?
Jan-Michael Kühn: Szenen haben ein gemeinsames Thema, das auf Verführungsbasis ästhetisch getrieben ist. Jeder kann potentiell mitmachen und auch wieder rausfallen. Subkulturen haben eine eigene Wert- und Normsetzung und zeichnen sich durch eine eigene Hierarchie aus. Innerhalb von Musikszenen existiert eine Coolness-Hierarchie, wo man urplötzlich durch einen Fehler von oben nach unten fallen kann, wenn man beispielsweise bei “Top of the Tops” auftritt.
Die Trennung zwischen Szenewirtschaft und Subkultur / Szene ergibt im Sinne der subkulturellen Ökonomieforschung natürlich Sinn, und auch im Abgleich mit der alltäglichen Clubrealität. Wie geht man aber mit dem nicht so kleinen Milieu um, das die Dinge primär aus soziopolitischen Gründen macht, das sich idealistisch in die Szenezusammenhänge einbringt? Spielen diese keine Rolle? Welcher Teilgruppe werden diese zugerechnet?
Jan-Michael Kühn: Das sind leidenschaftlich getrieben Menschen, die aber auch ökonomisch wirtschaften müssen. Die Szenwirtschaft definiert sich ja dadurch, dass die Leute ihren Leidenschaften folgen und diese mit dem ökonomischen Auskommen ausbalancieren. Es ist wichtig, als authentischer Akteur wahrgenommen zu werden. Wer für die Szene nachvollziehbar nur nach Profit strebt, der wird relativ schnell angefeindet und abgewertet.
Auf der anderen Seite steht in diesem kulturellen Feld die Musikindustrie, der es nur um Aufmerksamkeit und Absatz geht.
Christine, Jan-Michael, gibt es denn aus eurer Perspektive so etwas wie generelle Ablaufmodelle für den Werdungsprozess einer spezifischen Szene / Subkultur? Oder anders gefragt: ab welchem Punkt spielt Ökonomie tatsächlich als eigenständige Position eine Rolle? Oder ist die Idee eines gänzlich idealistischen Ursprungs zu naiv?
Jan-Michael Kühn: Es gibt einen klassisch biografischen Zugang zu solchen Musikszenen. In der Regel läuft das so ab, dass du die Musik bei Freunden zum ersten Mal hörst – ich habe beispielsweise das erste Mal Techno auf der Loveparade gehört –, dann irgendwann in den Club mitgehst, den DJ bewunderst und den Wunsch entwickelst selbst Tracks zu produzieren oder Partys zu veranstalten. Und dann bemerkt man plötzlich, dass das Veranstalten auch Geld kostet. Techno ist von Grundauf eine kommerzielle Sache, bei der man von Raummiete über DJ-Gagen Kosten hat, die man soweit reinholen muss, dass man zumindest keinen Verlust erwirtschaftet. Selbst jene, die aus Leidenschaft anfangen, merken irgendwann, dass, wenn nicht nur die Freunde und die Freunde der Freunde kommen, man sogar Geld damit verdienen kann – also fangen die Leute an, sich Geschäftsmodelle zu bauen.
Wobei es ja nach wie vor sehr viele unkommerzielle Akteure gibt, die es quasi als Hobby betreiben und sich so einbringen.
Jan-Michael Kühn: Das stimmt, das hält die Szene in Berlin ja so lebendig. Die Leute, die sich so verausgaben, ziehen dann eine andere Form von Belohnung daraus, sie haben eine gute Zeit, verwirklichen sich selbst und bekommen die Anerkennung der anderen.
Womit wir bei Bordieu und dem kulturellen Kapital wären. Christine, du widmest dich ja den Ungleichheiten von Szenen und Subkulturen am Beispiel der Türsteher. Ab welchem Evolutionsmoment einer Subkultur / Szene bedarf es solch einer Instanz denn überhaupt?
Christine Preiser: Rein sicherheitstechnisch geht das los, wenn die Leute merken, dass eben nicht nur die Freunde und die Freunde von Freunden kommen, sondern eine Menge an Leuten, die man nicht mehr kontrollieren kann und wo man nicht weiß, ob die alle in den Raum reinpassen. Von diesem Moment an gilt es eine Auswahl zu treffen.
Dieses Verlassen der privaten Räume kann man schön an Berichten aus dem Post-Wende-Berlin nachvollziehen, wo die anfängliche Vorstellung von „Techno ist für alle da“ der Erkenntnis wich, dass sich plötzlich auch Gruppen für die Musik zu interessieren begannen, die man nicht dabei haben wollte. Angefangen bei Nazis, aber auch Leute, die mitverdienen wollen. Also braucht man jemanden, der nüchtern genug ist und sich zuständig fühlt, um sich dem entgegen zu stellen.
Hast du bei der wissenschaftlichen Beschäftigung bemerkt, dass die Clubbetreiber und Partyorganisatoren damit hadern, diesen Moment einzuziehen? Man agiert ja plötzlich mit einer neuen Rolle gegen die ursprünglichen Intentionen.
Christine Preiser: Ne. Dass es Türsteher gibt, scheint unumstritten zu sein. Es gibt ja abseits von Autonomen Zentren wenige private Ausgeh-Orte, die keinen haben. Der Diskurs dreht sich eher darum, nach welchen Kriterien ausgewählt wird und was diese so betriebene Exklusion / Inklusion für Themen wie Rassismus bedeutet.
Die Geschichtsschreibung der Clubtür ist mindestens so schillernd wie die der Clubs selbst. Vom Studio 672 bis zum Berghain gilt: reinkommen ist alles. Was hier stattfindet, ist ja weit mehr als nur eine Sicherheitsmaßnahme, um die Unterschiedlichkeit der Interessierten hin zu dem zu kanalisieren, was man selbst als Klangfarbe seiner Clubbesucher definiert sehen möchte. Wie genau können denn Clubbetreiber und Türsteher, dieses Bild fassen?
Christine Preiser: Anspruch und Wirklichkeit gehen hier auseinander. Wenn man die Leute fragt, heißt es „Wir wollen keinen Rassismus an der Tür. Wir wollen ein Platz für alle sein. Bei uns ist jeder willkommen.“ Tatsächlich vor Ort sieht es aber anders aus. Was nicht heißt, dass man bewusst diskriminierende Entscheidungen fällt, aber eben dass Alltagsmomente mit reinspielen.
Bei aktuellen Diskussionen konnte man sehen, wie schnell Clubs mit inklusivem Anspruch an ihre Grenzen stoßen und neu kalibriert werden müssen. Grundsätzlich gilt: die Türsteher können nur mit dem Publikum arbeiten, das da ist. Nur wer in der Schlange steht, kann die Möglichkeit haben, reinzukommen – oder auch nicht. Die Mechanismen, die vorgelagert sind bei der Auswahl, die Art der Bewerbung, die Flyer, die Musik und der Eintrittspreis, liegen nicht im Entscheidungsraum der Türsteher.
Können die Akteure das Publikum, das sie gerne hätten, genau beschreiben?
Christine Preiser: Selten.
Und wie geht es sich mit den ökonomischen Interessen aus? Eine Tür zu machen bedeutet ja abgewiesene Gäste und somit reduzierter Umsatz – langfristig lockt die gepflegte Tür dann hoffentlich auch wieder Leute an. Finden die Akteure denn leicht ihr Gleichgewicht der Interessen?
Jan-Michael Kühn: Es ist ökonomisch in dem Sinne ein Problem, als dass es ein kulturelles Phänomen gibt, dass eine Party gut gefüllt sein muss, damit sie Spaß macht. Das Publikum ist also für sich selbst und für andere ein elementarer Bestandteil des Erlebnisses.
Wie Christine eben auch schon anmerkte, ist die Zusammensetzung des Publikums hierbei wichtig. Aus der Forschung weiß man, dass Clubpublikum eher homogen als heterogen ist. In den gesellschaftlichen Milieus, in denen wir heute leben, kommt es eher auf Ähnlichkeit an als auf Unterschiedlichkeit. Gerade in einer Szene mit multikulturellen Idealen ist es deswegen schwierig mit offener Exklusion umzugehen, so dass es dafür Mechanismen gibt. So kennen die Clubbesitzer und Türsteher sich gegenseitig gut und müssen deswegen die abwertenden Begriffe nicht offensichtlich benutzen, das geschieht unausgesprochen im Hintergrund.
Christine Preiser: Ich war in drei sehr unterschiedlichen Clubs für meine Arbeit. In dem einem war das Publikum sehr homogen, die Türsteher eingeschlossen. In den beiden anderen, wo es deutlich heterogener war, knallte es häufiger – je heterogener, je vielfältiger, desto mehr Risikopotential.
Die von mir angeführten Beispiele Studio 672 und Berghain sind insofern sehr passend, da hinter der hart geführten Tür – durchaus auch kritisierbar für ihre Auswahlprinzipien (Sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Kleidungsstil…) – die absolute Freiheit wartet(e). Wie passt dieses spezielle äußere Bild (womit nicht der gesellschaftliche Ruf gemeint ist, sondern eben die kulturelle Praxis an der Tür) und das innere zusammen?
Christine Preiser: Es ist eine sehr selektive Freiheit. Wie definiert man Freiheit überhaupt? Besteht sie darin, sich sexuell vor Ort frei auszuleben? Oder meint frei, Leute zu treffen, die ich sonst nicht treffe? So würde ich für mich das Ausgehen beispielsweise definieren – aber die Tür sieht dann anders aus als jene, wo man sehr selektive Freiheiten dahinter ausleben kann.
Jan-Michael Kühn: Freiheit ist ein sozial definierter Begriff. Es ist ja nicht so, dass es im Club generell sehr viel freier zugeht als draußen. Auch da gibt es rigide Regeln, wie man sich zu verhalten hat, was man machen darf und was nicht. Man darf im Club beispielsweise auch niemanden ermorden.
Aber du darfst zum Beispiel öffentlich Sex haben.
Christine Preiser: Aber keine Fotos machen!
Jan-Michael Kühn: Es gibt Sachen, die man im Club machen darf, die man sonst nicht machen kann: Drogen nehmen, Sex haben – aber auch nicht in jedem. Die Leute, die neu in den Club reingehen und die Regeln nicht kennen, die kommen mit den Leuten vor Ort nicht klar und laufen gegen die Wand. Um ein gutes Clubleben zu gewährleisten, müssen die Leute die Regeln lernen können. Wenn zu viele auf einmal neu reinkommen, der Turn-Over also zu groß ist, geht das nicht mehr.
Das Berghain ist insofern ein schlechtes Beispiel, weil es sehr heraussticht. Es gibt einen riesigen Ansturm, so dass sie viele Leute auf jeden Fall wegschicken müssen. Sie können nach Lust und Laune reinlassen. Das ist nicht repräsentativ für andere Clubs.
Christine Preiser: Es gibt ja viele Clubs, die nicht den Luxus der Auswahl haben. Viele haben eher zu wenig Gäste und können nicht jeden beliebig wegschicken. Da steht das Ökonomische im Vordergrund und nicht die genaue Komposition des Publikums.
Aber nochmals kurz zurück zu dieser Grenzlinie zwischen Innen und Außen.
Christine Preiser: Es gibt diese Grenze, aber sie fällt unterschiedlich stark aus. Es gibt einen nicht unbeträchtlichen Anteil an Menschen, die diese Zittererfahrung in der Schlagen machen und nicht wissen, ob sie reinkommen oder nicht. Aber es gibt auch viele, die völlig problemfrei die Grenze passieren. Letztlich ist die Schlange der Anti-Ort zur Tanzfläche. Die Leute werden, auch durch die Architektur, an der Tür diszipliniert. Sie müssen sich zwischen Gittern anstellen, treten einzeln vor den Türsteher und sollten dabei erwachsener und nüchternen wirken als sie sind – dahinter geht man dann wieder in der Masse unter, in der man sich frei bewegen kann.
Dieses von dir beschriebene Zusammenreißen vor dem Türsteher stellt einen oft nicht geringen Eingriff in die individuelle Identitätsgestaltung dar: von Dresscode über das Speaking in Different Tongues, da zum Beispiel Spanisch ungerne gehört wird an der Tür in Berlin. Sind diese Aspekte des Nadelöhr Tür den Protagonisten zumindest unangenehm?
Christine Preiser: Ja. Die meisten Türsteher empfinden das Leute-draußen-lassen nicht als den Lieblingsteil ihrer Beschäftigung. Zumal es ja auch der Moment ist, wo es zum Konfliktpotential für Ärger kommt. Das was die Türsteher machen, steht oft im Widerspruch zu ihnen als Person, ihr politischer und persönlich-ideeler Hintergrund weicht von dem ab, was sie da machen. Es ist ein Job und die Entscheidungen werden im Sinne des Clubbetreibers, der Gäste, der Party gefällt.
Christine, du warst für deine Doktorarbeit ja 60 Nächte an Clubtüren dabei. Was hast du dabei über den Umgang der Parteien miteinander gelernt?
Christine Preiser: Im Studium lernt man als qualitativ forschende Soziologin, wie man die Leute dazu ermutigt, zu erzählen – ich habe aber nie gelernt, wie man Leute dazu bringt, dass sie auch wieder die Klappe halten. Das gehört nicht zum Methodenrepertoire der Soziologen; das habe ich an der Tür gelernt. Und ich war verblüfft über die sehr ausgeprägte Menschenkenntnis von vielen Türstehern.
Jan-Michael Kühn: Ich habe auch einige Clubbetreiber kennengelernt, die ohne Ende quatschen und von Bauvorhaben und Verwaltungsrechten und all so Zeug erzählen.
Christine, wo hast du dich genau an der Tür aufgehalten?
Christine Preiser: Neben der Tür. Ich sah aus wie eine Türsteherin und war nicht als Forscherin erkennbar. Aber auch wenn ich nicht aktiv als Türsteherin arbeitete, so sorgte doch die Position bereits dafür, dass man mich dafür hielt, die Gäste behandelten mich als eine.
Hast du dich anders verhalten?
Christine Preiser: Meine Körperhaltung hat sich nachhaltig verändert und auch mein Verhalten im Clubraum. Wenn ich in einen Club reingehe, stelle ich mich erstmal an einen Ort, wo ich nichts im Rücken habe, um mir einen Überblick zu verschaffen. Als Gast bin ich viel proaktiver mittlerweile und spreche zum Beispiel Frauen an, wenn ich sehe, dass sie sich unwohl fühlen. Mein Blick für das Konfliktpotential im Nachtleben ist geschärft.
Für die Türsteher ist es der ganz normale Arbeitsbetrieb, aber wie gehen die Abgewiesenen damit um?
Christine Preiser: Ich bin nicht hinterhergelaufen, sondern habe nur den Teil im Blickfeld des Türstehers erforscht – da passiert schon einiges. Das Spektrum an Reaktionen reichte von Leuten, die sich lächerlich machten über solche, die einfach zum nächsten Club weiterzogen bis hin zu Leuten, die wiederkommen und eine Flasche werfen. Wobei das Gewaltpotential deutlich geringer ist, als immer erzählt wird – es wird mehr über Gewalt gesprochen als dass sie passiert.
Jan-Michael Kühn: Man kann sich so eine Schlange als gesellschaftliche Prüfung vorstellen. Es geht um die Anerkennung, die einem zugestanden oder verwehrt wird. Es geht darum, in den heiligen Kreis der subkulturellen Geschichte, die da stattfindet, hineingelassen zu werden. Psychologisch ist das ein Prozess der Auf oder Abwertung. Sozial betrachtet wirft das die Frage auf, wie man vor seinen Freunden dasteht: als jemand, der hineingekommen ist oder eben nicht.
Deswegen ist die Gästeliste ein gutes Beispiel. Leute, die draufstehen, streuen das performativ in Nebensätze ein, dass sie einen priviligierten Zugang haben. Es gibt eine relativ hohe Relevanz der subkulturellen Zugehörigkeit in unserer Gesellschaft. Wer nicht reinkommt, kann die Performanz nicht ausspielen. Das sind Gefühlswelten, über die wenig gesprochen wird, das bedeutet aber den Leuten sehr viel. Je länger man dabei ist, so normaler werden die Gästeliste und der Freisuff für die Leute – dann ist nur das Nichtkriegen auffällig.
Christine Preiser: Wobei das ortsgebunden ist. Zum Berghain gehen viele ja schon mit der Vorstellung hin, dass sie abgewiesen werden könnten. Es gibt also Schlangen, wo das Abgewiesenwerden dazugehört und selbst schon eine Form der Anerkennung darstellt. Wenn man ins Berghain oder Watergate nicht reinkommt, muss man das nicht persönlich nehmen, sondern ist Teil der großen Gruppe, die abgewiesen wird. Das Scheitern lässt sich integrieren. Wenn man aber nicht in einen Punkrock-Schuppen reinkommt, der dafür bekannt ist, keine selektive Türpolitik zu haben, dann hat das was mit dir zu tun.
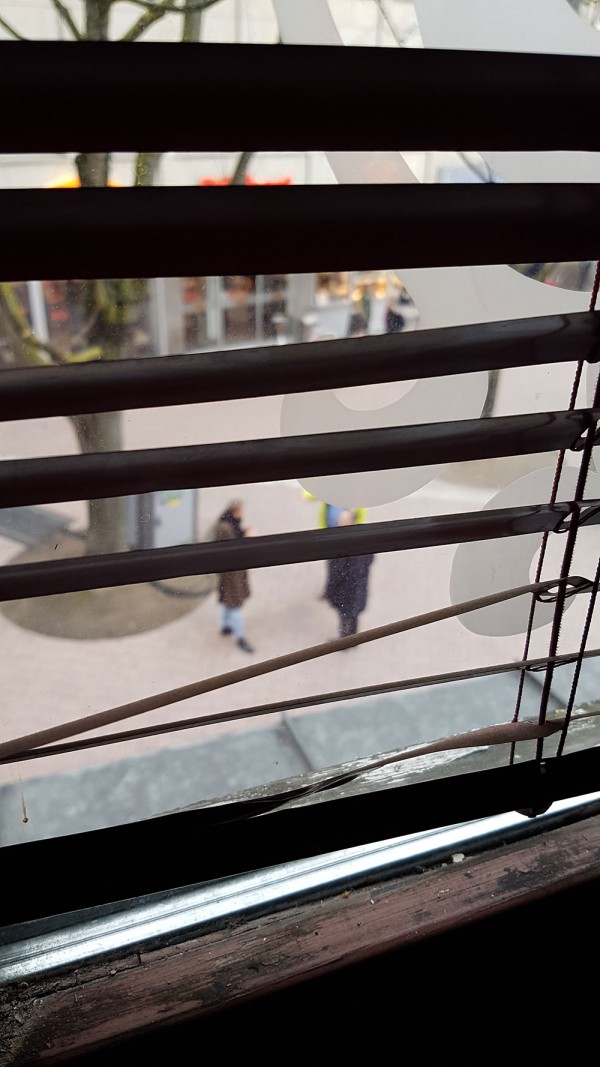 Um nochmals auf den ökonomischen Aspekt zurück zu kommen. Solange ein Club bestens läuft, ist die harte Tür ein Luxus, den er sich leisten kann und vielleicht auch des Images wegen muss. Was aber wenn es nicht so gut läuft? Habt ihr Erkenntnisse, wie sich dann die Freiheiten der Türsteher, die sie vom Clubbetreiber erhalten, verändern und wie sich dieser Prozess en Detail abspielt? Denn die Türsteher in ihrer Autorität zu untergraben ist ja eigentlich ein no-go.
Um nochmals auf den ökonomischen Aspekt zurück zu kommen. Solange ein Club bestens läuft, ist die harte Tür ein Luxus, den er sich leisten kann und vielleicht auch des Images wegen muss. Was aber wenn es nicht so gut läuft? Habt ihr Erkenntnisse, wie sich dann die Freiheiten der Türsteher, die sie vom Clubbetreiber erhalten, verändern und wie sich dieser Prozess en Detail abspielt? Denn die Türsteher in ihrer Autorität zu untergraben ist ja eigentlich ein no-go.
Christine Preiser: Ja, die Clubs öffnen die Tür, wenn es nicht so gut läuft – mit zumeist mittelfristigen Konsequenzen. Viele Leute bleiben dann weg, da sie das Exklusivere erwarten – und wenn plötzlich alle rein kommen führt das zu ihrer Abwesenheit. Es bringt also nicht mit sich, dass der Club zwangsläufig besser läuft. Die Clubbetreiber versuchen das Umlenken aber oft nicht über die Tür, sondern über Fremdveranstaltungsreihen zu beeinflussen.
Jan-Michael Kühn: Clubs haben ein klassisches Problem: Nach einer Hype-Phase am Anfang ebbt das Interesse an ihnen schnell ab und dann muss man ökonomisch umdenken und den Erlebniswert immer wieder neu schaffen. Man öffnet sich, macht Kooperationen mit anderen Veranstaltern, die Musik wird kommerzieller, eingängiger , mehrheitsfähiger, man fährt größere Bookings, steht unter dem Druck ein, zweimal im Jahr eine Kracherparty hinbekommen zu müssen, um wieder richtig ins Gespräch zu kommen..
Zum Schluss möchte ich noch über den Aspekt Sicherheit sprechen, der in den letzten Jahren nun auch bei uns – in Ländern wie Israel, Kolumbien oder Libanon war dies nie anders – handlungsleitend wurde. Könnt ihr Auswirkungen auf Szenezusammensetzungsprozesse beobachten im Sinne dass auch subkulturell mehr Ausgrenzung stattfindet? Hat sich die scheinbar gewachsene potentielle Bedrohung auf die Kommunikationsform zwischen Türstehern und Besuchern ausgewirkt?
Christine Preiser: Du sprichst auf die zuletzt statt gefundenen gezielten Anschläge auf Clubs an, da es sich bei ihnen um eine Form von Massenveranstaltung mit Symbolwert handelt. An den Türen, die ich kenne, wurde das kurz diskutiert, aber die Praktiken wurden deswegen nicht geändert, da sie bereits dafür ausgelegt waren und das Wissen existiert, dass man bestimmte Dinge eben nicht kontrollieren kann. Man kann Leute nicht durchleuchten, um zu sehen, was sie dabei haben.
Jan-Michael Kühn: Aber es wird heute mehr körperlich untersucht am Clubeingang. Aber es stimmt: Nach dem Anschlag in Orlando hatte man mit sehr viel Aktionismus gerechnet, aber dazu ist es nicht gekommen.
Christine Preiser: Weil die Leute an der Tür zu erfahren sind mit Gewalt. Für die ist es kein neues Thema und Risiko. Viele, die lange dabei sind, die wissen, dass die Gewalt grundsätzlich sinkt, auch im Nachtleben. Jene, die schon in den 90ern im Nachtleben gearbeitet haben, sagen, dass es damals ganz anders geknallt hat: Massenschlägereien, Gewalt mit Waffen, das ist heute so nicht mehr präsent.
Jan-Michael Kühn: Das ist sehr milieuabhängig. Die Clubkultur ist ja sehr vom Bildungsbürgertum geprägt. Da gibt es ein geringeres Potential an Gewaltbereitschaft. In Diskotheken sieht es anders aus, da ist die Gewalt und das Ausmaß an Belästigung um ein Vielfaches höher.
Christine Preiser: Letzte Woche wurden in Berlin im Havana zwei Türsteher aus einem vorbeifahrenden Auto angeschossen. Vor drei Jahren wurde im Soda Club ein Türsteher erschossen. Diese Momente sind in der Szene den Leuten bewusst: “Ja, es gibt als Türsteher auch ein Risiko, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.” Es ist wahrscheinlicher vor dem Havana angeschossen zu werden, als dass im Havana ein Terroranschlag stattfindet.
Ein schönes Schlusswort.



















