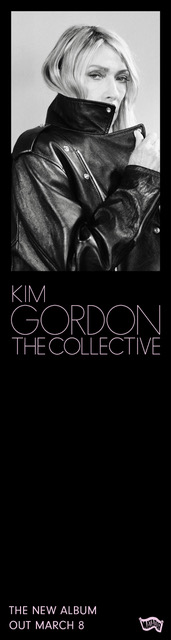Scott Walker: „Ich verlasse den Körper nicht sehr oft“

Scott Walker (Still aus: “Scott Walker – Rosary (Live 1995 on Jools Holland)” – Quelle Youtube)
Aus der Musiker-Generation, die ihre großen Erfolge noch im Swinging London der 60er Jahre feierte, ist Scott Walker mit Sicherheit als rätselhaftester Protagonist hervorgegangen. Nach der Trennung der Walker Brothers im Jahre 1967 nimmt er vier existenzialistische Meisterwerke des Orchester-Pomps auf, die allesamt von Walkers unbeschreiblicher Stimme veredelt werden. Immer schon zur Introspektion neigend, zieht sich Walker mit Beginn der späten 70er und frühen 80er immer mehr aus dem Alltag des Pop-Geschäfts zurück, um in zunehmend größeren Abständen stetig unzugänglichere Brocken von LPs zu veröffentlichen.
Anlässlich “Bish Bosch” durfte Mario Lasar einen seiner großen Helden 2012 für Intro in Paris zum Interview treffen. Wir freuen uns sehr über einen “Nachdruck” im Rahmen unserer Kaput-Revisited-Reihe.
Der Titel Deines neuen Albums kann auf verschiedene Weise verstanden werden. Im Pressetext erfährt man, dass „Bish Bosch“ zum einen auf Hieronymos Bosch verweist. Zum anderen ist „bish“ eine Variation von „bitch“. Außerdem ist es ein Slangausdruck, der dafür steht, eine Arbeit beendet zu haben.
Scott Walker: Der Titel kam zuletzt. Er passte gut, weil die Songtexte häufig auf Wortspielen basieren.
Hast Du denn jemals das Gefühl, dass ein Album wirklich fertig ist?
SW: Nein (lacht). Mir gefällt am Titel eigentlich am meisten der physische Aspekt (klatscht in die Hände): Bish Bosch. Fast so, als würde jemand gegen etwas schlagen. Das hat mich sehr angezogen, mehr als alles andere.
Mir ist aufgefallen, dass die Texte zwar sehr mit Bedeutung aufgeladen sind, aber immer auch lautmalerische Elemente enthalten, die kaum Bedeutung haben, wie etwa „heya“ (aus „Pilgrim“) oder „A Dink A Dink A Doo“ (aus „Dimple“), bei denen es mehr um Klang geht. Strebst du so etwas an?
SW: Es ist alles Teil davon, die Musik interessant zu machen während sie entsteht. Ich habe schon oft erwähnt, dass ich immer mit den Texten beginne. Ich arbeite sehr lange daran, den Text hinzukriegen. Wenn das funktioniert, zeigt es mir, wie der Rest laufen muss. Der Text suggeriert mir auch , welche Sounds ich benutze. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Text und Musik aufeinander bezogen sind.
Es ist ziemlich offensichtlich, dass deine Texte über die Maßen ambitioniert sind, vor allem, weil sie gerade beim neuen Album mit Referenzen gespickt sind, die von Astronomie bis Politik reichen.
SW: Bei diesem Album bin ich einen Schritt weiter gegangen. Ich hatte es bei anderen Musikern noch nicht so beobachtet, also habe ich versucht, etwas Neues qua Sprache zu schaffen. Die Referenzen kommen einfach durch Geduld zustande. Es braucht seine Zeit. Sie haben sich im Unterbewußtsein eingenistet und melden sich irgendwann, um abgerufen zu werden.
Aber ist es so, dass du nach den Referenzen suchst, oder kommen sie dir unter?
SW: Nein, sie kommen mir so unter. Ich lese vielleicht etwas, das eine bestimmte Bedeutung hat. Ich tausche dann manchmal den Begriff gegen einen anderen aus, der eine ähnliche Bedeutung hat…naja, das klingt jetzt etwas mysteriös. Deswegen rede ich nicht so gern über diesen Prozess des Textens (lacht). Ich bin etwas abergläubisch, was dieses Thema angeht. Ich könnte dir irgendeinen Quatsch über eine Art mysteriösen Prozess erzählen, der einerseits einer Lüge gleichkäme, andererseits aber ebenso oft einfach der Wahrheit entspricht. Man könnte natürlich die Entstehung der Texte analysieren, aber warum sollte man das tun? Es ruiniert die Idee.
Du hast bereits in den 60ern Songs geschrieben, die auf Filme oder Bücher verweisen, etwa „The Plague“ auf Albert Camus oder „The Seventh Seal“ auf Ingmar Bergman, aber dein heutiger Ansatz scheint mehr auf einer Montage dieser Verweise zu basieren.
SW: Ja, die Songs machen verschiedene Angebote. Sie sind wie ein Wandteppich, der eine eigene Welt darstellt. Die einzelnen Teile der Songs sind zwar aufeinander bezogen, aber in puncto Logik sollen sie nicht zusammen passen. T.S. Eliot hat auch so gearbeitet. Auf diese Weise generiert man eine Geste der Widersprüchlichkeit.
Wie übersetzt sich diese Arbeitsweise in die Musik? Würdest du sagen, dass die Texte und die Musik heute in einem direkteren Verhältnis zueinander stehen?
SW: Ja, absolut. Die Musik arbeitet sich an den Texten und ihrer Atmosphäre ab. Es gibt keine traditionelle Art und Weise, diese Musik hervorzubringen. Man kann sich nicht mit einem Gitarristen oder Pianisten zusammensetzen und ihnen Noten geben, die dann die Musik bestimmen. Sobald der Text fertig ist, muss man sofort damit beginnen, die Musik zu arrangieren – obwohl ich die Musik eigentlich nicht mehr arrangiere. Ich entwickle eher eine Art Layout, in das die Songs eingefügt werden. Diese Skizze, die ich am Keyboard erstelle, macht etwa 70 Prozent des fertigen Stücks aus, der Rest wird dann im Studio vervollständigt. Dabei geht es darum, die Sounds zum Leben zu erwecken, sie mittels Spontaneität mit Wirklichkeit aufzuladen.
Also kann man schon sagen, dass Du Demo-Aufnahmen machst? Ich erinnere mich daran gelesen zu haben, dass Du es eigentlich hasst, so etwas machen zu müssen.
SW: Ich muss es machen, weil es die Arbeit so sehr erleichtert. Ich kann mich daran erinnern, wie ich an Tilt arbeitete, ein Album, das vor einigen Jahren herauskam (1995, ML). Damals hatte ich kein Keyboard, und ich musste den Musikern jedes kleine Detail im Studio erklären, das war furchtbar anstrengend.
Würdest Du sagen, dass die drei Alben “Tilt”, “The Drift” und “Bish Bosch” eine Entwicklung dokumentieren, die sich stetig weiter entfernt von Arrangements zugunsten physischer Sounds, die mehr das Geräusch an sich in den Vordergrund stellen?
SW: Ich denke, ja. Wir haben mittlerweile einen bestimmten Stil entwickelt, aus dem wir schöpfen können. Ein Stil, der stark den sonischen Aspekt betont. Diesen Stil können wir manipulieren und variieren wie es uns gefällt. Ein Beispiel dafür ist, dass wir auf dem neuen Album sehr viel weniger Bass benutzen als auf The Drift, das sehr von tiefen Frequenzen geprägt war. Dieses Mal ist der Bass nur an den Stellen präsent, wo die Stimmung ihn suggeriert. Den Rest belasssen wir freistehend. Auf diese Weise gibt es keinen festen Boden. Beim Hören bekommt man ein Gefühl der Unruhe, weil es nichts gibt, was alles miteinander verbindet.
Kann man das Stilmittel der Stille, das auf dem neuen Album eine große Rolle spielt, auch unter diesem Aspekt betrachten? Die Musik scheint häufig verschluckt zu werden, als Hörer fühlt man sich in diesen Momenten verloren.
SW: Ja, weil einem der Boden unter den Füßen wegbricht. Die Funktion der Stille variiert natürlich. In „Zercon, A Flagpole Sitter“ geht es ja unter anderem um diesen Hofnarren. An einer Stelle im Song wird er von einem Zwischenrufer gestört. Die Stille in dem Song ist als Antwort auf den Zwischenrufer konzipiert, der sich als Folge davon schuldig fühlt. Die Stille ist das, von wo aus alles beginnt. Es ist eine spirituelle Trope (siehe Anmerkungen am Ende des Textes). Du hast ja vielleicht gelesen, dass wir für dieses Album sowohl analoge als auch digitale Aufnahmetechnik verwendet haben. Immer, wenn die Stille einsetzt, findet ein Wechsel vom analogen zum digitalen Aufnahmemodus statt, weil der analoge Modus keine pure Stille möglich macht, selbst wenn das Band sehr schnell läuft. Mir ist bewusst, dass auch digitale Technik keine völlig pure Stille wiedergibt, aber sie kommt ihr näher.
Ich habe gelesen, dass Du für dieses Album eine Tubax benutzt hast, ein seltenes, obskures Instrument, das eine Kreuzung zwischen Tuba und Saxofon darstellt. Ich habe mich gefragt, ob dem eine ähnliche Funktion zukommt wie dem Wechsel zwischen analog und digital, nämlich, einen Ansatz zu finden, der es einem ermöglicht, die Musik innovativ und neu klingen zu lassen.
SW: Ja. Da die Texte einen neuen Weg beschreiten, muss die Musik ebenso ausgerichtet sein. Wenn man neue Musik machen will, kann man sich nicht an alten Blues-Stücken orientieren, die man schon eine Million mal gehört hat. Zumal man dann Gefahr läuft, auch auf alte Weise Texte zu schreiben, am Ende noch darauf zu achten, dass sich die Endsilben reimen – das wäre so langweilig. Also will man es so interessant wie möglich machen, um etwas zu schaffen, das man vorher noch nicht gehört hat. Unabhängig davon, ob man es als Hörer liebt oder hasst.
Glaubst du, dass der Ansatz einer neuen Musik auch neue Gefühle im Publikum hervorrufen kann?
SW: Ich weiß nicht, man lebt und hofft.
Du machst dir also keine Gedanken darüber, wie die Musik aufgenommen wird?
SW: Solange ich glaube, dass es funktioniert und mein musikalischer Partner Peter Walsh und die Musiker auch davon überzeugt sind, weiß ich, dass ich nicht komplett falsch liege.
Folgen sie dir überall hin? Ich weiß, dass Du für “The Drift” einen toten Tierkadaver als Schlagzeug benutzt hast…
SW: (lacht) Ich könnte heute eine Herde Vieh durchs Studio treiben, und niemand würde sich wundern. Meine Musiker sind es gewohnt, außergewöhnliche Arbeitsweisen zu akzeptieren. Sie sind eben großartige Musiker.
Wann würdest du den Zeitpunkt ansetzen, an dem deine Musik sich verändert hat in Richtung spröderer Klänge? Als du mit den Walker Brothers 1978 “Nite Flights” (siehe Anmerkungen am Ende des Textes) gemacht hast?
SW: Ja, genau.
Weißt du noch, wie diese Veränderung motiviert war?
SW: Geschichte motiviert alles. Die Zeit, in der man lebt und arbeitet ist immer ein entscheidender Faktor. 1978 stand noch sehr im Zeichen der Energie von Punk, sie war sehr präsent in meiner Umgebung. Die Musik der Zeit diktiert, was man machen wird. Man muss auf das hören, was um einen herum passiert. In der Zeit davor machte ich eine sehr schlimme Phase durch, weil ich nicht auf mich selbst hörte. Als klar war, dass GTO, das Label, das die Walker Brothers in den 70ern unter Vertrag hatte, pleite gehen würde, gaben sie uns einen Freischein, das zu machen, was wir wollten. Daraus entstand dann Nite Flights. Auf diese Weise hat sich mir eine neue Tür geöffnet. Sie war wieder so offen wie in den 60ern.
Was, denkst Du heute, war der Grund dafür, dass sich die Tür überhaupt schloss? Hast Du zu sehr kommerzielle Erwägungen in den Vordergrund gestellt?
SW: Nein, das war es nicht. Was passierte, war, dass mein viertes Solo-Album total flopte.
Was heute seltsam erscheint.
SW: Ja, heute lieben die Leute es. Jedenfalls trat die Plattenfirma nach dem Desaster von Scott 4 an mich heran und sagte mir, ich müsste entweder etwas Kommerzielles aufnehmen oder die Firma verlassen. Ich hatte also eine Wahl. Leider habe ich die falsche Wahl getroffen, indem ich blieb. Ich dachte damals, ich könnte vielleicht ein, zwei leichtere Alben aufnehmen, ein bisschen Geld verdienen, aber immer mit dem Hintergedanken, im Anschluss wieder selbstbestimmte Platten machen zu können. Aber das funktionierte nicht. Dann ging ich zu CBS, die mir sagten, ich könne frei über die Gestaltung der Musik entscheiden, was sich als Lüge herausstellte, als wir anfingen, das erste Album aufzunehmen. Leider ordnete ich mich dem Diktat von CBS unter. Davon wurde ich depressiv, und irgendwann war es mir egal, was ich sang. Mit Nite Flights endete diese Periode.
Verfolgst Du die aktuelle Musiklandschaft eigentlich?
SW: Ich verfolge nicht, was in der Popmusik passiert. Es erscheint mir lächerlich, das zu tun, weil die Dinge sich so schnell verändern, praktisch jede Woche. Aber wenn Radiohead oder eine vergleichbare Band ein neues Album herausbringt, lese ich darüber in der Presse und höre es mir dann auf i-tunes an.
Wie stehst du zu Leuten wie Björk oder Brian Eno? Betrachtest Du sie vielleicht als geistesverwandt?
SW: Ja, auf jeden Fall. Alle Leute, die für einen anderen Zugang zur Musik stehen. Mit Brian bin ich auch befreundet.
Ich habe gehört, dass Björk mit selbstgebauten Instrumenten arbeitet. Kannst Du dir so etwas auch vorstellen?
SW: Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe davon gehört und finde es interessant. Aber momentan bin ich nicht so sehr daran interessiert, für mich etwas in der Art in Betracht zu ziehen.
Glaubst Du, dass der Umstand, dass Musiker es für nötig erachten, über neue Ansätze der Musik nachzudenken, etwas über den Zustand der Musik an sich aussagt? Man könnte sich fragen, ob es vor diesem Hintergrund nicht ein Problem mit dem gegenwärtigen Zustand der Musik gibt. Vielleicht ist sie leer geworden. Oder sie wird zumindest so empfunden.
SW: Ich glaube, die Leute, die sagen, die Musik sei formalisiert und erstarrt, haben recht. Wenn jeder immer nur kopiert, wird es nie etwas Neues oder Anderes geben. Das gilt natürlich besonders für Musik aus den Charts. Brian (Eno) redet oft davon, wie leer ihm viele aktuelle Musik vorkommt.
Gab es nicht mal einen Zeitpunkt, wo es hieß, dass Du mit Brian Eno zusammenarbeiten würdest?
SW: Wir haben angefangen. Brian hatte Daniel Lanois (siehe Anmerkungen am Ende des Textes) mitgebracht, und ich bin nicht mit Daniels Arbeitsweise klargekommen. Also war es innerhalb eines Abends vorbei.
Wie stehst Du angesichts deiner Einschätzung, Musik tendiere dazu formalisiert zu werden, zu dem Phänomen der Retromania, über das in letzter Zeit viel gesprochen wurde?
SW: Das ist ja im Grunde nur ein Ausdruck der Postmoderne, oder? Leute bedienen sich eines durchgesetzten, etablierten Stils. Das Problem besteht darin, dass sie es oft zu sehr übertreiben. Und dann werden sie zu Tribute-Künstlern. Nicht gut.
Glaubst Du, dass es Parallelen gibt zu Bands aus den 60ern, die heute immer noch tingeln?
SW: Ich sollte kein Urteil fällen über diese Bands, sie tun es aus unterschiedlichsten Gründen, Geld spielt eine große Rolle dabei. Und natürlich ist es ihre letzte Chance, nochmal zu spielen bevor sie für immer auschecken.
Hast Du noch Kontakt mit Leuten aus den 60ern?
SW: Nein, die Leute aus den 60ern hassen mich! Die sind nicht mehr Teil meines Publikums.
Wenn Du ein neues Album aufnimmst, arbeitest Du ununterbrochen daran?
SW: Diesmal nicht, normalerweise aber schon. Ich hatte einen großen Plan. Es sollte alles ganz schnell gehen. Das Schreiben ging auch wirklich sehr schnell, es hat weniger als ein Jahr gedauert, was für mich fast Lichtgeschwindigkeit ist. Ich dachte, ich buche das Studio für acht Wochen, und dann sind wir raus, fantastisch. Tatsächlich hat es dann zwei Jahre gedauert (lacht). Zuerst ist Peter Walshs Vater gestorben, dann mussten wir an einem Projekt für das Royal Opera House arbeiten. Danach war dann das Studio belegt und einige der Musiker waren unterwegs auf Tournee. Wir konnten drei Tage lang aufnehmen, und dann mussten wir eine zweimonatige Unterbrechung in Kauf nehmen. Es zog sich also hin, und ich musste alles im Kopf behalten, was ich mir für die Aufnahmen überlegt hatte. Es hat mich verrückt gemacht. Ich war glücklich, als es endlich vorbei war. Jedenfalls hat mein toller Plan nicht funktioniert.
Wenn man sich die Album-Credits anguckt, fällt immer wieder die hohe Anzahl von Musikern auf, die an deinen Platten beteiligt sind. Ich weiß noch, dass ich im Fall von “The Drift” gedacht habe: Mein Gott, 4AD sind jetzt wahrscheinlich pleite.
SW: Es ist einfach unser Sound jetzt. 4AD sind wirklich toll. Sie stellen mir ein größeres Budget zur Verfügung als früher die Majors. Sie schätzen es, dass wir diese Musiker brauchen, damit wir unsere Vision umsetzen können. Natürlich benutze ich Musiker heute nicht mehr dazu, Arrangements auszuarbeiten und zu spielen. Es geht nur noch um Effekte. Nichts, gar nichts, kann eine große Streicher-Sektion ersetzen. Ein Synthesizer wird niemals diese Form von Gewicht erzeugen. Ein wirkliches Streichorchester ist einfach fantastisch. Das gleiche gilt für den Klang einer Orgel (siehe Anmerkungen am Ende des Textes).
Du glaubst also immer noch an traditionelle Instrumente?
SW: Wir haben auch mit elektronischen Mitteln gearbeitet, weil es in der Luft liegt. Aber ich hoffe, wir haben eine gute Balance geschaffen.
Ich fand, dass die Art, wie die Texte graphisch gestaltet sind, ihre Anordnung auf der Seite, sehr an gedruckte Theaterstücke erinnert. Ist das Absicht?
SW: Eigentlich nicht. Obwohl es stimmt, dass Texte für mich immer eine sehr physische Qualität besitzen. Sie sehen aus wie Soldaten im Feld, die sich bewegen.
Mein Eindruck rührte wahrscheinlich daher, dass es in der gedruckten Version der Texte quasi Regieanweisungen gibt, die sich auf die Musik beziehen, obwohl die Musik im Medium des Papiers keine Rolle spielt.
SW: Es ist mir schon wichtig, dass die Texte auch ohne Musik funktionieren. Es ist natürlich nicht der Idealzustand, aber ich habe nichts dagegen, wenn Leute die Texte losgelöst von der Musik, ihrer auralen Dimension, rezipieren wollen. Leonard Cohen sagt, dass das, was er schreibt pure Poesie sei, sogar, wenn er es mit Musik unterlegt. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, jedenfalls nicht in bezug auf meine Arbeit. Poesie passt nicht immer mit Musik zusammen. Man kann sie natürlich künstlich zusammenbringen. Mein Ansatz ist sehr hybrid angelegt, während Leonard Cohen in einer traditionellen Form schreibt, die sich am klassischen Reimschema orientiert.
Würdest Du sagen, dass dein Ansatz weniger eingeschränkt ist? Es scheint dir immer darum zu gehen, über Grenzen hinauszuweisen.
SW: Vielleicht weil ich Reimen skeptisch gegenüber stehe. Man ist immer eingeschränkt, wenn man so arbeitet. Es gibt meistens nur vier oder fünf Optionen, wenn man Texte schreibt, die darauf ausgerichtet sind, sich zu reimen. Es geht auch hier darum, etwas frisch zu halten.
Gibt es Platz für Humor in deiner Musik?
SW: Ja, definitiv. Ich denke immer daran, dass Franz Kafka angeblich seine neuen Texte seinen Freunden vorzulesen pflegte und jedesmal enttäuscht gewesen sein soll, wenn sie nicht lachten.
Das Konzept der Hybridität oder Ambiguität ist wahrscheinlich wichtig in dieser Hinsicht, oder? Es gibt einem die Möglichkeit zu entscheiden, wie man deine Musik verstehen will.
SW: Ja, ich möchte nicht festlegen, wie etwas zu verstehen ist. Vielleicht haben die Leute bessere Ideen als ich, was die Interpretation meiner Musik und Texte angeht.
Ziemlich demokratisch. Obwohl man hört, dass Du von Diktatoren fasziniert bist. Auf deinem letzten Album hast Du dich mit Mussolini auseinandergesetzt, diesmal ist es Ceausescu. Woher kommt dieses Interesse?
SW: Sie sind lustige Clowns, oder? Gleichzeitig sind sie natürlich sehr gefährlich. Aber die meisten sehen so absurd aus, so überzeichnet. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater mir erzählte, dass er, nachdem er Hitler in der Wochenschau gesehen hatte, nicht glauben konnte, wie viele Leute diesem Mann folgten.
Du hast eben selbst die physische Qualität deiner Texte erwähnt. Dabei fällt vor allem auf, wie unmittelbar physisch die Texte gestaltet sind. Begriffe wie „bone structure“, „protein“, „shit“ oder die Beschreibung grotesker Körper in dem Stück „Pilgrim“ sind in der Hinsicht deutliche Belege. Dadurch gibt es kaum Platz für Sublimierung oder Idealisierung, die normalerweise typisch sind für jede Kunstform.
SW: Tatsächlich sind die meisten meiner Songs, auch schon auf The Drift und wahrscheinlich auch auf Tilt – obwohl ich es schon lange nicht mehr gehört habe – um den Körper zentriert. Der Körper spielt eine große Rolle. Ich verlasse den Körper nicht sehr oft. Es geht immer darum, wie wir in der Welt situiert sind, und durch „körperliche“ Begriffe kommt am besten diese physische Verbindung zwischen Mensch und Welt zur Geltung.
Gleichzeitig sagst Du im Interview mit Rob Young von der englischen Zeitschrift The Wire, dass deine Kunst im Grunde spirituell sei.
SW: Das bezieht sich auf den Aspekt, über den wir vorhin schon sprachen: dass man einen Text schreibt, und selbst nicht weiß, woher die Worte kommen. Ich bin kein Mystiker, an so etwas glaube ich nicht. Dennoch muss man sich dem kreativen Prozess öffnen.
Hörst Du dir eigentlich jemals deine alten Platten an?
SW: Nein, ich höre mir nie etwas an, sobald ein Album abgeschlossen ist. Warum sollte ich? Ich habe ein oder zwei Jahre damit zugebracht, die Texte zu schreiben, die Musik zu skizzieren, die Texte einzusingen und das Material zu mixen. Danach kann das Publikum dann mit der Platte leben.
Aber der Grund dafür ist nicht, dass Du befürchtest, nachträglich noch etwas ändern zu wollen, oder?
SW: Doch, das ist auch einer der Gründe. Ich glaube, es geht jedem so, der ein Kunstwerk in die Welt setzt. Man denkt immer, dass man irgend etwas hätte besser machen können.
Du hast vor vielen Jahren, Jahrzehnten, aufgehört live zu spielen. Wie kam es dazu?
SW: Ja, es ist schon sehr lange her. Der Live-Sound damals war so schlecht, man konnte das, was im Studio möglich war, auf der Bühne nie reproduzieren. In der Hinsicht bin ich schon immer sehr perfektionistisch gewesen. Es war nicht so schlimm wie bei Glenn Gould, der es für masochistisch hielt, live zu spielen. Aber ich wurde sehr frustriert, weil alles immer falsch klang. Ich dachte, dass es die Mühe nicht lohne. Schließlich war ich nicht mehr daran gewöhnt, live zu spielen. Aber jedesmal, wenn ich die Arbeit an einem neuen Album beginne, sage ich mir, dass ich beim Schreiben darauf achten werde, dass man es auch live umsetzen kann. Aber dann übernimmt meine Phantasie die Kontrolle, und die Streicher und das ganze Zeug kommen ins Spiel, und so entwickelt sich jedes Album zu diesem Monster, mit dem man nicht auf Tournee gehen kann. Niemand würde Geld verdienen, und ich würde wahrscheinlich auf der Bühne Selbstmord begehen. Nächstes Jahr fange ich wieder an zu schreiben, mit demselben Plan. Vielleicht gelingt es mir dieses Mal, mich daran zu halten. Ich schaffe es kaum noch, mir die Leute vom Leib zu halten, die mich nach der Möglichkeit von Konzerten fragen, ich muss es wahrscheinlich einfach machen. Wir werden sehen.
__________________________________________________________________________________________
Trope: Es ist bezeichnend, dass Scott Walker sich hier eines Ausdrucks bedient, der aus der Rhetorik stammt, einer sprachzentrierten Disziplin also. Damit wird angedeutet, dass auch Musik Bedeutung produziert und eine Intention verfolgen kann. Auch wenn Walker auf seinen jüngsten Alben an einer Umsetzung reiner Intensität zu arbeiten scheint, kommt der Musik immer auch eine repräsentative Funktion zu. Hier offenbart sich eine Form von Klang gewordener Hybridität, die Walkers Schaffen so einzigartig macht.
Nite Flights: Das formal herausragende Stück des Albums stellt „The Electrician“ dar. Hier deutet sich zum ersten Mal das Wechselspiel zwischen Schönheit und düsterstem Abgrund an, das Scott Walkers Musik heute auf die Spitze treibt.
Ein statisch-spannungsgeladenes Streichermotiv, das von monotonen Bassschlägen punktiert wird, mündet in ein von lieblichen spanischen Gitarren begleitetes Crescendo, das Erlösung zu versprechen scheint, nur um im nächsten Moment wieder den Schritt in den Abgrund vorzubreiten: „There’s no help, no“, hören wir Scott singen. Die Musik bestätigt das aufs eindrucksvollste.
Daniel Lanois: Heute ein gefragter Produzent, der zuerst ins Rampenlicht trat, als er zusammen mit Brian Eno die beiden U2-Alben The Unforgettable Fire und The Joshua Tree produzierte. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören weiterhin Bob Dylans Oh Mercy und Peter Gabriels So. Lanois wird häufig für seinen tendenziell konturlosen, gleichförmigen Waber-Sound kritisiert.
Orgel: Die Schwere, die Scott Walker hier echten, traditionellen Instrumenten, wie eben auch der Orgel zuschreibt, lässt sich bereits auf einer frühen Walker-Brothers-Aufnahme von 1966 wiederfinden: „Archangel“ wartet mit einer bombastischen Kirchenorgel auf, deren raumfüllender, sinfonischer Präsenz man sich nicht entziehen kann.