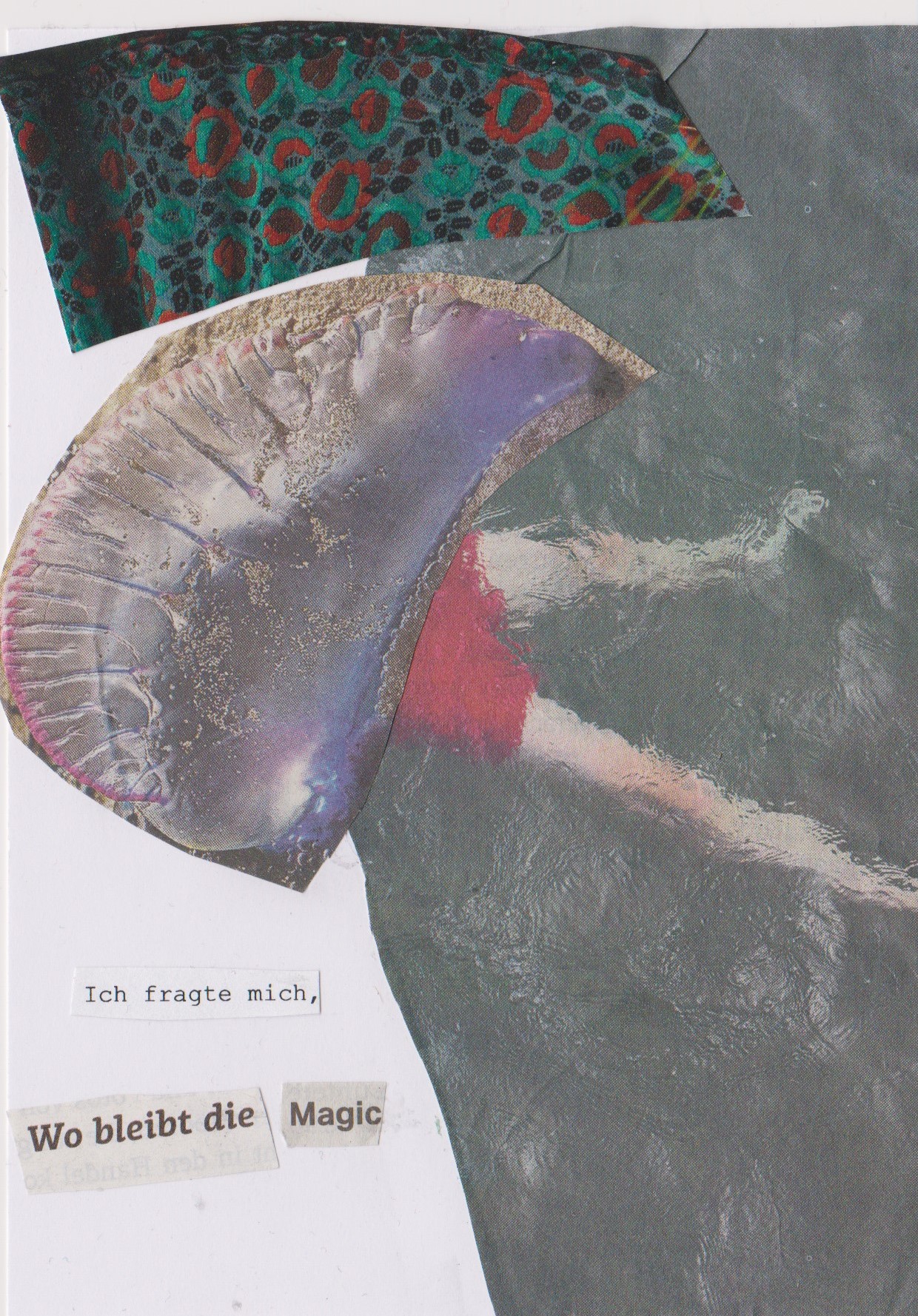Das Nichts im Pop
Es gibt eine Meme-Seite auf Instagram, die Casual Nihilism heißt und von einem indischen Studenten betrieben wird. Man könnte sie als nihilistischen kleinen Bruder des mit zwei Millionen Abonnenten allseits beliebten Accounts classicalfuck bezeichnen, der seit Jahren das Internet mit amüsanten Sprüchen beglückt. Es ist die Kernkompetenz von Casual Nihilism, die Sinnlosigkeit allen Seins humorvoll aufzubereiten. Am 15. April 2021 teilte der Account eine Texttafel, auf der stand:
„My pronouns are: none. Please do not refer to me. Even better: Do not perceive me. For practical purposes, I don’t exist.“
Was für ein schön schlecht gelaunter Beitrag zum Thema Identitätspolitik. Weil: Wer ist man schon, so rein erdgeschichtlich gesehen? Es gab einen ja viel länger nicht, als dass es einen gibt. Und man ist auch viel mehr etwas nicht, als dass man etwas ist. Oscar Wilde schrieb in „Das Bildnis des Dorian Gray“: „To define is to limit“; der Lyriker Walt Whitman fand in seinem Gedicht „Song of Myself“ die Worte: „Very well then I contradict myself, I am large, I contain multitudes“. Oder aktueller: Der ghanaisch-amerikanische Songwriter Moses Sumney beschreibt es in dem Song „also also also and and and“ aus seinem 2020 erschienen Album „Græ“ so: „I insist upon my right to be multiple“. Es ist heute sehr wichtig, was wir alles sind. Dabei wird außer Acht gelassen, was wir alles nicht sind: das meiste.
Die Komplettverweigerung von Casual Nihilism erinnert an unsere relative Bedeutungslosigkeit. Was für eine angenehme Abwechslung! Vor allem erinnert sie an etwas, das in aktuellen Debatten unterrepräsentiert ist: das Nichts. Oder die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt, wie Albert Camus es in „Der Fremde“ bezeichnete, und die in der Popkultur derzeit einen schweren Stand hat.
Es ist absolut langweilig zu wiederholen, dass unsere Gesellschaft narzisstisch ist, gäbe es „Wetten, dass..?“ noch, sogar beim Smalltalk auf Gottschalks Sofa zwischen einer nassforschen Eierlaufwette und einem Auftritt von Chris de Burgh wäre diese Erkenntnis angekommen. Und wir können ja noch nicht einmal etwas dafür: Gerade in den Medienberufen müssen wir ja ganz besonders und ganz wichtig sein, sonst kommt nämlich ein 22-jähriger Praktikant aus Paderborn und nimmt uns den Arbeitsplatz weg, den wir selbst aber eigentlich gar nicht mehr haben, weil er circa 2018 weg-ge-rebrushed wurde. Kapitalismus oder Koroner, irgendein Arschloch ist immer.
Da auf Social Media jede News zur Selbstdarstellung aufbereitet wird, scheinen manche mittlerweile vor den Kopf gestoßen, wenn man sich dem entzieht. Sophie Passmann schrieb am 8. Mai 2021 in ihrem Essay „Im Internet posten ist wie Forelle essen“ in der NZZ: „Da alle plappern, machen sich diejenigen verdächtig, die es vorziehen zu schweigen. Die sozialen Netzwerke funktionieren heute so wie früher das Fischessen an Aschermittwoch: Statt Freiheit herrschen Kontrolle und Gruppenzwang.“
In ihrem Artikel beobachtet sie mit Unbehagen, dass es natürlich ganz und gar nicht so ist, wie Rechte und Verschwörungsspinner meinen, also dass man angeblich nichts mehr sagen könne, sondern dass ein neues, problematisches Phänomen vielmehr ist, dass man nicht nichts sagen könne. Kritik, Unterstellungen und allerhand Deuteleien, was die Abstinenz bei bestimmten Themen angeblich offenbart, ließen nicht lange auf sich warten, wenn man sich mit seiner Meinung mal zurückhielte, so Passmann. „Wenn sich die Vorzeichen aber so umkehren, dass nicht mehr das Sprechen, sondern das Schweigen in einer Debatte begründet werden muss, steigt die Menge an nicht relevanten Statements genauso wie die Menge an Phantasie-Diskursen, in denen Leute sich gegenseitig Argumente vorspielen, die zwar nicht ihrer eigenen Überzeugung entsprechen, aber wenigstens möglichst geringe Kollateralschäden nach sich ziehen“, schreibt Passmann.
Anders ausgedrückt: Hallo?! Wir sind im Internet, HIER WIRD VERDAMMT NOCHMAL GEMEINT!!!1!!
Jeder Tweet und jeder Post ist eine Art Mini-Pressekonferenz, sodass nicht nur das gesprochen wird, was besonders gut ist, sondern das, was besonders gut für das eigene Narrativ ist. Das trägt zur eigenen Markenbildung bei, weil ein Statement im Internet ja oft nicht den Zweck hat, die Welt zu erklären, sondern das Selbst. Der irische Schriftsteller Hubert Butler schrieb in „Balkan Essays“: „We write for those who agree with us“. Wäre es nicht fruchtbarer, es wäre andersherum?
Kurzum: Was nicht geteilt wird, scheint nicht zu existieren. Man könnte auch sagen: Aus „photo or it didn’t happen“ ist „post or it didn’t happen“ geworden. Das ist ein Trugschluss. Nicht-Sagen sollte nicht mit Nicht-Haltung verwechselt werden, weil man viel sagen (= posten) kann, wenn der Tag lang ist, sich aber im Handeln zeigt, was nur digitale Lippenbekenntnis war.
Doch egal, wie klug, reflektiert, differenziert ein Post auch sein mag: Er bleibt immer eine Verkürzung, allein schon, weil Form, Aufbau und Funktionsweise der sozialen Medien nicht für Vieldeutigkeit ausgelegt ist. Das Nichts walten zu lassen kann also eine bewusste Entscheidung der De-Eskalation sein, den Fronten nicht noch mehr Futter zu liefern, oder auch einfach der gag-igen Gefallsucht. Ijoma Mangold und Lars Weisbrod analysierten im Feuilleton-Podcast „Die sogenannte Gegenwart“ in der Folge vom 19. April 2021 über Humor, dass heutzutage sogar jeder Betonmischer auf Social Media lustig sein muss. Das ist anstrengend. Vielleicht könnte die Verinnerlichung des Nichts sogar die ultimative Heilung des Massennarzissmus sein?
Zurück also zum Nichts. Das Meisterwerk des Nichts im Pop ist natürlich 4’33’’ von John Cage. Im revolutionären Musikstück des Avantgarde-Komponisten ist kein einziger Ton zu hören. Es wird bis heute debattiert, ob es dabei um die Stille geht, oder ob sich das Werk aus den Umgebungsgeräuschen konstituiert.
Einem der größten Popstars unserer Zeit, Lana Del Rey, wird immer wieder ihre Vagheit zur Last gelegt, ein im 21. Jahrhundert seltsam unzeitgemäßer Vorwurf, und dass sie sich nicht genug „verhalte“ zu Dingen, überhaupt manchmal wie weggetreten wirke und wie durch ihr eigenes Storytelling irrlichternd. Sie studierte an der Fordham University in der Bronx Philosophie mit Schwerpunkt Metaphysik. „Feminismus ist für mich einfach kein so interessantes Konzept“, sagte sie etwa in einem vielzitierten Interview mit FADER, sie interessiere sich mehr für „unsere intergalaktischen Möglichkeiten“. Vielleicht wollte Lana damit sagen, sie interessiere sich einfach zu sehr für das Nichts, das sie früher mit oft falsch verstandener Todessehnsucht auskleidete und heute mit Patina und Parliaments.
Was würde das Nichts eigentlich machen, wenn es sich ein Wochenende lang auf der Erde rumtreiben würde? Das fragte sich auch der serbische Regisseur Boris Mitić, und mit ihm 60 Kameraleute aus über 70 Ländern. Dabei herausgekommen ist der unvergleichliche Dokumentarfilm „In Praise Of Nothing“ von 2017, bei dem niemand Geringeres als Iggy Pop das Nichts eingesprochen hat, das sich aus dem Off direkt (und in Reimen!) an den Zuschauenden wendet. Unterlegt sind die beeindruckenden Bilder mit dem Soundtrack der Tiger Lillies. 78 Minuten Nicht-Film – so schön kann es sein.
Die Epilog, Zeitschrift zur Gegenwartskultur, brachte 2018 ein Heft heraus mit dem Thema Irrelevanz, mit so wunderbaren Texten wie etwa „Mein Tag als Brausetablette“. In dem phantasierte der Autor Kai Schnier, sich in der warmen Badewanne ganz aufzulösen. Das Bemerkenswerte an dieser Ausgabe ist, dass die Publizierenden das Publizieren selbst auf den Kopf stellen, denn in den Medien wird in der Regel nur über das Außergewöhnliche berichtet, was passiert ist. Dabei ist der Normalfall doch: Es passiert nichts.
Zwei deutsche Städte widmeten dem Nichts sogar je eine Gedenktafel. Auf dem Marktplatz im brandenburgischen Kyritz ist zu lesen: „Dieser Stein erinnert an den 14.02.1842 – Hier geschah um 10.57 Uhr NICHTS“, und in Schwerte bei Dortmund steht auf einem Schildchen geschrieben: „Genau an dieser Stelle ereignete sich am 15. Mai des Jahres 1785 überhaupt gar nichts“.
Auch Die Epilog thematisiert im Heft, wie sehr sich das Selbst aus Abgrenzung speist. Autor und Technikphilosoph Mads Pankow schreibt in seinem Essay „Nothing really matters“: „Erst die Identitätspolitik holte die Abwehrhaltung, in diesem Fall gegenüber der Diskursmacht von alten weißen Männern, wieder als Sinn- und Wertstifter zurück. Das Geheimnis allen Strebens wurde im Menschen selbst vermutet, in der tiefen Meditation über eine essenzielle Innerlichkeit, die dann durch hypermodernes Arrangement beliebiger kultureller Artefakte nach außen getragen werden sollte.“
Es ist übrigens erstaunlich, wie völlig selbstverständlich das Ad-hominem-Argument in Identitätspolitik-Debatten normalisiert ist: „Als alter weißer Mann kannst du zum Thema XY mal schön deinen Mund halten“, lautet es so oder so ähnlich in den Grabenkämpfen, was bekanntermaßen nur ein Scheinargument ist und einen echten Austausch verunmöglicht, da eine Aussage unabhängig von der Person, die sie tätigt, bewertet werden sollte und nicht weniger stichhaltig ist, nur weil sie jemand sagt, den man satt hat.
Oder wie es der Philosoph Markus Gabriel im Podcast „Hotel Matze“ am 14. April 2021 lakonisch auf den Punkt brachte: Der „alte weiße Mann“ ist halt auch noch da. Der geht nicht weg, nur weil man ihn nicht dabeihaben will – und sei es aus guten Gründen. Vielleicht möchte man sich einfach festhalten im Äther, verständlicherweise, und sei es nur an der eigenen Meinung als Verortung im Nichts. Dreh- und Angelpunkt in Internetdebatten ist daher oft die eigene Empfindung: Sie ist Grundlage, Legitimation und Argument in einem. „Wenn ich es so fühle, dann ist das so.“ Ähm, nein?
Aber wir sind alle gefragt, man sollte sich nicht derart viel anmaßen, so als Menschheit, weil so crazy sind wir halt auch nicht, wir bestehen aus sehr gewöhnlichen Kohlenstoffverbindungen, wie Champignons etwa, oder Farn, wir rennen deutlich langsamer als ein Gepard und haben vier Rollen weniger am Körper als ein handelsüblicher Einkaufswagen, und derselbe Zufall, der aus mir mich gemacht und nicht den immer zu laut Techno hörenden Gamer aus dem 2. Stock, aus mir auch hätte ihn machen können, deswegen will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Vielleicht sollten wir, wenn wir aus dem allgemeinen Schlamassel wieder herauskommen wollen, nicht immer weiter tweeten und tröten, was uns alle voneinander unterscheidet, als Nationen, Gesellschaften, Gruppen, Personen, sondern, ganz kitschig, was uns alle verbindet: nämlich das große Nichts. Bis dahin können wir ja gemeinsam in Dauerschleife 4’33’’ hören.