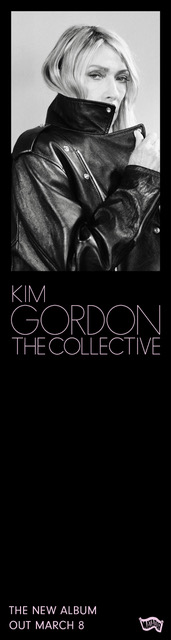“Ein Schaumbad ist mehr instagrammable als ein Wartezimmer” – Pop und Mental Health
Mit trübem Wetter und nie hell werdenden Herbsttagen zieht der November die Stimmung der Menschen konsequent nach unten. Ob saisonale Depressionen, Dauerzustand oder andere psychische Erkrankungen – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich dem Thema Mental Health Issues und Musik zu widmen.
Im letzten Teil der Serie, nimmt die Kuratorin der Reihe ROSALIE ERNST eine kritische Position ein. Der Artikel entstand nach einem Gespräch mit dem Musik-Sozial-Psychologen Dr. Mats Küssner über mögliche Probleme, die aufkommen, wenn psychische Krankheiten in Popmusik verhandelt werden.

Lea Wessels
Entstigmatisierung durch Popmusik
Dass psychische Krankheiten entstigmatisiert werden sollten, ist mittlerweile bei vielen angekommen. Doch das alleine reicht nicht, denn auch 2019 wird das Wort “Therapie” oft genug nur hinter vorgehaltener Hand oder im Flüsterton ausgesprochen. Noch immer fällt es schwer als AngestellteR eine Therapie in den Arbeitsrhythmus einzubinden und Medikationen werden wesentlich kritischer betrachtet, als so manch andere Pille. Bei einem wertfreien Verständnis von psychischen Krankheiten, ist man also noch lange nicht angekommen.
Gerade gegenüber Depressionen hat sich allerdings in den letzten Jahren das gesellschaftliche Bild gewandelt, was nicht zuletzt an der inhaltlichen Auseinandersetzung mit psychischen Krankheitsbildern innerhalb der glänzenden Welt der Popkultur liegt. Doch was sind die Gefahren, psychische Krankheiten in Popmusik zu besingen und in der Popkultur für die Entstigmatisierung zu stehen? Bei all dem Mut und Einsatz, den MusikerInnen in den vergangenen Jahren aufgebracht haben, um mit ihrem Publikum und teilweise auch darüber hinaus über psychische Erkrankungen zu kommunizieren, gibt es auch Kehrseiten dieser Offenheit.
Ritzen zu My Chemical Romance
Das größte Beispiel für mögliche Gefahren ist die Jugendkultur Emo, die sich in den 2000ern um die Band My Chemical Romance gebildet hat. In den Liedern wurden düstere Themen von Depression, Mobbing und Tod bis hin zu Suizid verarbeitet: „So give me all your poison, And give me all your pills, And give me all your hopeless hearts, And make me ill, You’re running after something, That you’ll never kill“ (“Thank you for the Venom”)
„If you look in the mirror, And don’t like what you see, You can find out, What it’s like to be me“ („The End“)
Auf Konzerten wurde über die Notwendigkeit von Therapie- und Hilfsangeboten gesprochen und sie trugen die eigenen Mental Health Kämpfe ziemlich offen aus. Dennoch etablierte sich innerhalb der Jugendlichen Emo-Bewegung ein sehr ungesundes Verhältnis zur mentalen Gesundheit. Der rapide Erfolg von My Chemical Romance brachte den fünf Jungen aus New Jersey weltweite Fanscharen ein, die die thematisierten Krankheiten glorifizierten, was so weit ging, dass selbstverletzendes Verhalten, Teil der Jugendkultur wurde. Die Wunden wurden offen wie Accessoires präsentiert und auch die Fashionindustrie sprang schnell auf den Emo-Hype auf: Zahlreiche T-Shirts mit fragwürdigen Prints kamen in den Umlauf und so wurde aus dem wichtigen Thema, ein Trend. Die Entwicklung sorgte nicht für die Entstigmatisierung und einer sachlichen Debatte über den Umgang mit psychischen Erkrankungen und schadete letztlich nicht nur der Band, sondern vor allem denen, die tatsächlich mit psychischen Krankheiten zu kämpfen hatten und für die selbstverletzendes Verhalten nicht nur ein Kult mit bitterem Beigeschmack war. Dass dieses weltweite Phänomen aus der Debatte herausgehalten wird, engt den Diskurs ein und ignoriert, dass diese Trend-Gefahr nach wie vor besteht.
Dass der schnelllebige Kapitalismus gerade in den sozialen Netzwerken vor nichts Halt macht, zeigen jüngste Perversionen wie “Blackfishing” mehr als deutlich. Genauso wie ‚Schwarz-sein‘ im Nu zu einem unreflektierten Trend wurde, können auch psychische Krankheiten zu einem Trend werden, der die ohnehin schwammigen Grenzen des Diskurses zu einem großen geblurrten Wirrwarr machen. Ehe man sich versieht landen Songs in den Charts, die Depressionen beschreiben, doch im Refrain dann frische Luft und Grapefruits als optimale Lösung präsentieren. Bilder von hübschen kuscheligen Betten und einem Tee werden als ansprechende Insta-Depression präsentiert oder eine Ästhetik von Selbstliebe, Selfcare und Achtsamkeit soll das optimale Gegenmittel für Angststörungen sein. Klar, sind gerade letztgenannte Trends nicht schlecht für ein gesundes Selbstbild, aber psychische Krankheiten, dürfen nicht damit in Zusammenhang gebracht werden. Denn was gegen eine diagnostizierte Depression hilft, geht darüber hinaus und Therapie und medizinische Versorgung ist das einzige Mittel gegen die Krankheit. Aber ein Wartezimmer sieht eben nicht ganz so instagrammable aus wie eine überschäumende Badewanne.
Die Tradition des leidenden Künstlers
Es ist also wichtig, dass die MusikerInnen, bei der deutlichen Thematisierung von psychischen Erkrankungen, Verantwortung übernehmen und Trend-Entwicklungen von Anfang an entgegentreten. Genauso wichtig ist es, dass die Krankheiten nicht Teil der Künstler-Identität werden. Denn die Huldigung von großen Persönlichkeiten mit psychischen Krankheiten, hat eine viel längere Geschichte: Das kranke Genie, der depressive Künstler – zugleich gesegnet und gepeinigt von seinem Geist und seiner Kreativität, von der Gesellschaft verstoßen und postum verehrt – ein Bild, das während der Jahrhundertwende (19./20.) im Geniekult seinen Höhepunkt fand. Der Kult hatte einen bitteren Beigeschmack, denn die zum “Genie” ausgerufenen, waren so gut wie ausnahmslos weiße Männer. Noch heute wird ein großer Teil der gesellschaftlichen Vorbilder aus dieser Zeit und durch die teilweise sehr abstruse Legitimation des “Genie-Titels” bezogen. Das Bild der leidenden Seele, die sich in die Kunst rettet, des einsamen Mannes, dem unverstanden von der Gesellschaft einzig und allein das Erschaffen selbst bleibt, hat sich bis heute durchgesetzt. Das wird nicht zu Letzt klar, wenn es dann um Selbstmorde von KünstlerInnen geht, die teilweise genauso verklärt werden, wie es damals der Fall war. Der “Club 27” ist die manifestierte Mystifizierung und Romantisierung von Suizid und auch zu dieser Ansammlung an verstorbenen MusikerInnen gibt es eine Vielzahl an Produkten, die ihre Tat ganz nach 1900-Tradition verherrlichen, romantisieren und mystifizieren.
Gegenüber dem Trend, der Romantisierung und Glorifizierung, steht ein wesentlich diffuseres Phänomen: Die fadenscheinige Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen.
Im vergangenen Monat erschien das Buch „It’s NOT okay to feel blue sometimes (and other lies)“, indem zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens über ihre Mental Health Issues sprechen. Die Lektüre ist überaus reflektiert und wurde sorgfältig von Scarlett Curtis kuratiert und genau solche Veröffentlichungen ergänzen die musikalischen Inhalte auf einer Ebene, die die nötige Tiefe und Ernsthaftigkeit zulassen. Die Lobeshymnen in den Medien überschlugen sich und der Mut wurde beklatscht. Obwohl der Umgang sehr respektvoll war, thematisierten die Artikel dennoch nur in Bruchteilen, die tatsächlichen Probleme und die Lösungen: nämlich ärztliche Hilfe.
Die Kreativität wurde viel eher fokussiert und noch immer weiß kaum einer, wie man denn nun mit der besten Freundin spricht, die gerade wegen Panikattacken nicht mehr raus möchte. Es wird Distanz gewahrt, wo keine sein sollte und draufgehalten, wo Abstand zwingend notwendig wäre.
Denn letztlich bildet auch dieses Buch nur eine kleine Nische psychischer Störungen ab. Es zeigt nur die Sicht von Leuten, die mit ihren Problemen abgeschlossen haben oder bereits eine selbstreflektierte Sichtweise einnehmen können. Und das ist der springende Punkt: Mit seinen Problemen aus eigenem Willen und kontrolliert an die Öffentlichkeit zu gehen, ist bereits ein großes Privileg und wird mit der nötigen Anerkennung gewürdigt. Das steht allerdings nicht im Verhältnis zum tatsächlichen Umgang mit psychischen Krankheiten, Zusammenbrüchen und Krisen, die in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.
Es ist leicht, den Mut zu beklatschen und im gleichen Atemzug über Übersprungshandlungen, wie das Rasieren einer Glatze, auch noch 12 Jahre später, Witze zu machen, Jojo-Gewicht abzutun, Models mit offensichtlichen Essstörungen nach ihren persönlichen Diät-Tipps zu fragen und voyeuristisch einen bipolaren Rapper zu begaffen, um mit dem nächsten Meme viral zu gehen.
Die intensive, gesamtheitliche Auseinandersetzung mit psychischen Problemen, Krankheiten aller Art ist ein zentrales Thema, dem sich die Gesellschaft widmen muss und die nicht nur MusikerInnen, AutorInnen und der Popkultur überlassen werden darf. Kultur ist schon immer eine treibende Kraft des gesellschaftlichen Wandels, doch bringt diese Rolle Risiken mit sich. Dabei muss der Umgang mit psychisch Kranken, mit depressiven Menschen, mit bipolaren Menschen, Schizophrenen, und Menschen mit Angststörungen zum Common-Sense werden. Sowohl in den Öffentlichen Räumen und Zuhause muss ein Verständnis für Mental Health Issues herrschen, genauso wie ein nachhaltiger medialer Umgang mit erkrankten Personen des Öffentlichen Lebens zwingend notwendig ist. Noch bestehen viele tiefgreifende Gefahren, die auch die Kreativen selbst berücksichtigen müssen und die für ihren mutigen Kampf gegen Stigmatisierung von Mental Health Issues unumgänglich sind.
Text: Rosalie Ernst
____________________________
Unmittelbare Hilfe findet ihr hier:
www.deutsche-depressionshilfe.de/krisentelefone
Link zum Terminservice, um im Bedarfsfall eine Therapie finden zu können: www.bundesgesundheitsministerium.de/terminservicestellen/#c1869