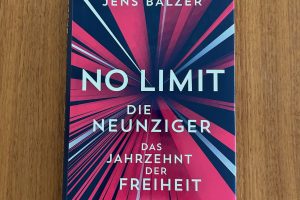Aufarbeitung der verlorenen Zeit
Techno mit den Schlümpfen, der Aufstieg von Eurodance und Nirvana, die neue Tattoo-Kultur. Aber auch der erste Krieg in Europa seit 1945 im ehemaligen Jugoslawien und rechtsextreme Jugendkultur in Deutschland: Es geht um die Neunziger Jahre. Der Pop-Experte Jens Balzer hat ein Buch über dieses Jahrzehnt geschrieben. „No Limit. Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit“ ist rasante Geschichtsschreibung im Spiegel der Popkultur und Abschluss einer Trilogie.
Philipp Kressmann hat mit Jens Balzer über dessen neues Buch gesprochen.
Der Buchtitel „No Limit“ spielt auf den gleichnamigen Eurodance-Hit von 2 Unlimited an. Du analysierst im Buch den Songtext und das Musikvideo. Eine Szene liest Du auch als Beispiel für den musikwirtschaftlichen Kapitalismus jener Zeit. Wieso erschien Dir dieser Songtitel so passend als Buchtitel?
„No Limit“ ist schon ein Signature-Song für die Neunziger, für die Stimmung zumindest am Beginn des Jahrzehnts. Der Kalte Krieg ist zu Ende, alle Grenzen sind – scheinbar – offen, „No Borders“ ist in „No Limits“ mit inbegriffen. Das Eingezwängte der Achtziger, ihre von Angst geprägte Stimmung – beides ist erst einmal weg.
Andererseits heißt „No Limit“ eben auch: Es gibt kein Limit mehr, was das Geldverdienen angeht, und: Es gibt keine Grenzen mehr für den Kapitalismus. Wer den Siegeszug des Kapitalismus für sich zu nutzen verstand, sowohl im Techno, in der Musikindustrie als auch in jedem anderen ökonomischen, gesellschaftlichen Feld, der konnte sehr schnell sehr reich werden. Wer das nicht konnte, zählte aber noch schneller zu den Verlierern. Ich finde, das schlägt sich hier auch musikalisch nieder: Wenn man sich überlegt, wie ein Song mit dem Titel „No Limit“ in den Siebzigern geklungen hätte, wäre das wahrscheinlich eine 20-minütige Prog-Improvisation gewesen, uferlos, entgrenzt. In den Neunzigern ist es ein zackig vorgetragener Imperativ: Du musst jetzt Geld verdienen und wenn Du die Chance nicht nutzt, dann bist Du ein Loser. Im Eurodance wird man auch viel angeschrien. Es ist eine sehr imperativische Musik, man kann und soll sich ihr nicht entziehen.
Im Buch tauchen viele etablierte Pop-Stars auf. Du schreibst im Kontext Rassismus nach der Wiedervereinigung aber auch über HipHop-Gruppen mit internationaler Geschichte wie Advanced Chemistry und Microphone Mafia. Die sind heute leider eher in Vergessenheit geraten. Wie wichtig war es Dir, an diese Bands zu erinnern?
Es gibt eine gewisse Kontinuität in der Trilogie: Wenn man eine deutsche Gesellschaftsgeschichte erzählt, dann ist das immer auch eine Geschichte über Migration. Schon in meinem vorigen Buch über die Achtziger („High Energy“, Anmerkung P.K.) gibt es ein ausführliches Kapitel über die sogenannte Gastarbeiter-Musik, über das Türküola-Label, über Sängerinnen und Sänger wie Yüksel Özkasap und Metin Türkoz. Das ist die erste und die zweite Generation der Arbeitsmigranten. Die haben seit den späten 60ern sehr viel Musik verkauft, Hunderttausende Tonträger, vor allem Kassetten, ohne dass das jemals in den Charts gelistet worden wäre. Die wurden von der Mehrheitsgesellschaft ignoriert. In den Neunzigern wurde Musik von Migrantinnen und Migranten erstmals tatsächlich von einem breiten Publikum wahrgenommen – darin spiegelt sich, dass sich das Land als Einwanderungsgesellschaft wahrzunehmen beginnt. Und gleichzeitig gibt es zum ersten Mal ein popkulturelles Genre, das sich gegen Rassismus wendet – und dafür eine eigene Sprache findet, ein migrantisch-deutsches vernacular, wenn Du so willst. Das hat es in der deutschsprachigen Pop-Musik so noch nicht gegeben – und hat weit darüber ausgestrahlt. Ein paar Jahre später ist es auch in der Literatur angekommen und hat etwa mit „Kanak Sprak“ von Feridun Zaimoğlu das Kulturbürgertum erreicht. Die Literatur orientierte sich an den Vorleistungen jener Hip-Hopper.
Du zitierst im Buch auch Eleonore Wiedenroth, eine Autorin und Gründungsmitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. In einem Artikel für ein feministisches Magazin erklärte sie 1993 ausführlich, warum das N-Wort rassistisch und diskriminierend ist. Viele haben aber darauf beharrt, es weiter zu verwenden und fühlten sich von einer angeblichen Sprachpolizei drangsaliert. Man erfährt auch, dass der Klimawandel von vielen Personen als bloßes „Hirngespinst“ abgetan wurde. Waren die Neunziger also viel rückschrittlicher, als oberflächlich betrachtet?
Na ja, sie waren insofern schon fortschrittlich, als zum ersten Mal überhaupt Stimmen von People of Color durchdringen konnten, die sich gegen rassistische Begriffe wie das N-Wort wandten – irre ist, wie schrill dagegen sofort opponiert wurde, mit den gleichen Begrifflichkeiten wie heute, „Terror der politischen Korrektheit“ und so… Rückschrittlich waren die Neunziger in jedem Fall in Bezug auf ökologische Themen. Ich bin Jahrgang 69, in den Achtzigern begeisterten wir uns als Jugendliche für die Grünen, wir waren gegen Atomkraft, gingen auf die Demonstrationen in Gorleben und in Wackersdorf, Ökologie war in der Mitte der Gegenkulturen. In den Neunzigern war das wie weggeblasen, als habe sich mit dem Ende des Kalten Kriegs auch die ökologische Frage erledigt. Dafür interessierten sich nicht mal mehr die Grünen. Joschka Fischer, der große Star der Partei in den Neunzigern, war von allen grünen Politikern derjenige, der sich mit Abstand am wenigsten an ökologischen Fragen orientierte. Der hat da auch mal mitgemacht, aber es war nie sein Herzensthema. Dabei gab es 1988 den ersten Bericht eines NASA-Wissenschaftlers, in dem eigentlich alle Fakten auf dem Tisch liegen. Sowohl was den Klimawandel betrifft, als auch wie der CO2-Ausstoß bis 2000 reduziert werden muss, wenn man das Schlimmste abwenden will. Es passierte aber nichts, im Gegenteil, alle fingen an, in riesigen SUVs rumzufahren und mit Billigfliegern um die Welt zu jetten. Die Neunziger sind das Jahrzehnt, in dem so viel Energie und so viele Ressourcen verschwendet worden sind wie in keinem zuvor. Das ist natürlich, gerade aus heutiger Perspektive, ein enormer Rückschritt. Generell konnten wir in den Achtzigern Sozialisierte mit dem, was in den Neunzigern an Konsumbegeisterung aufpoppte, nichts anfangen. 1985 wäre ich als 16-jähriger im Leben nicht auf die Idee gekommen, Markenkleidung zu tragen. Alle stylten sich selber, mit Ausnahme der Popper allenfalls. Dann kam die Hip-Hop-Kultur und in den Neunzigern liefen alle plötzlich mit riesigen Adidas-Markenlogos rum. Diese Konsumakzeptanz war mir fremd.
Was mich etwas verwundert hat: Die große Britpop-Welle ist zum Beispiel gar kein Thema im Buch. Vermutlich sollte der Umfang nicht so gigantisch werden, oder?
Ehrlich gesagt, keine Musik könnte mir egaler als Britpop sein. Davon abgesehen, gibt es noch viel andere Musik aus den Neunzigern, die in dem Buch auch nicht vorkommt und mir selber damals wichtiger war, Jungle, Drum’n’Bass… Die ganze Trilogie – über die 70er, 80er und 90er – handelt ja nicht von Musik als solcher, schon gar nicht in irgendwie enzyklopädischer Weise, sondern nimmt Musik immer dann in den Blick, wenn sie eine gesellschaftliche Transformation widerspiegelt. Das, was man anhand von Britpop erzählen könnte – also: die Renaissance des Nationalismus im Pop –, habe ich versucht, am Beispiel der Spice Girls zu erläutern, die ich in ihrer Ambivalenz immerhin interessanter finde als so öde Macho-Retro-Bands wie Oasis. Bei den Spice Girls gibt es einerseits dieses postmodern Verspielte: eine Girl-Group, die Elemente aus allen Epochen enthielt. Und andererseits diese politisch absolut reaktionäre Seite: Union Jack, Patriotismus, Thatcher-Bewunderung, Turbokapitalismus. Im Video zu „Wannabe“ crashen sie eine Party von reichen Leuten, aber reißen am Anfang erst einmal einem Obdachlosen höhnisch die Mütze vom Kopf. Im Sinne von: „Deine Armut kotzt uns an.“ Was für eine krass reaktionäre Band das war! Wenn ich mit Leuten in deinem Alter spreche, Ende der Achtziger oder Anfang der Neunziger geboren, höre ich immer, dass sie die Spice Girls in ihrer Kindheit für eine feministische Empowerment-Gruppe gehalten haben. Was für ein Irrtum…
Während weiße Boygroups aus den Neunzigern wie die Backstreet Boys oder *NSYNC konzeptuell ja auf Schwarzen Gruppen wie etwa Boys II Men basieren…
Klar. Man könnte da auch nochmal eine Debatte über kulturelle Aneignung führen. Auch Britney Spears ist ohne Schwarzen RnB aus der Zeit nicht zu denken. Aber das hätte für mich in diesem Zusammenhang zu weit geführt. Es geht mir in dem Buch um die Neunziger als ein Jahrzehnt, in dem man Utopien und enttäuschte Utopien findet. Die Menschen hoffen auf universelle Freiheit, aber müssen dann schnell lernen, dass unterschiedliche Menschen sehr unterschiedliche Dinge unter Freiheit verstehen. Auch Nazis haben einen Freiheitsbegriff. Die wollen halt national befreite Zonen.
Im ersten Kapitel beschreibst Du ausführlich und detailliert die Grenzöffnung und das Ende der DDR. In dem Kontext zitierst Du auch „Das Ende der Geschichte“ des Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama. Dieses Werk taucht auch kurz im Essay „Kapitalistischer Realismus ohne Alternative?“ von Mark Fisher auf. „It is easier to imagine an end to the world than an end to capitalism“, steht bei Fisher und ist auch ein Zitat. Als ich mit Deinem Buch fertig war, habe ich den Eindruck gewonnen, dass sich dieses Gefühl der Alternativlosigkeit vor allem in den Neunzigern etabliert hat.
Die letzte wirklich große Hoffnung war die Etablierung des Internets als Gegenöffentlichkeit und Gegenkultur. Ich zitiere ja auch Hakim Bey mit den „Temporären Autonomen Zonen“ („TAZ“ heißt dessen Buch, das 1991 auf deutsch erscheint, Anmerkung P.K.) oder die Agentur Bilwet. Ich denke an die ersten Internet-Theoretiker, die wirklich große Hoffnungen in die anarchisch-libertären, rhizomatischen Potentiale des Internets gesetzt haben. Dann dauert es nicht mal drei Jahre, bis Amazon gegründet wird. Und nochmal drei Jahre später wird das Patent auf den Cookie erteilt, das heißt, aus dem großen, anarchischen Netz schält sich schon das universale Überwachungsinstrument heraus, das das Internet heute ist. Bezüglich der Diagnose von Mark Fisher: Das ist mir – wie das meiste bei Fisher – zu vulgärmarxistisch, zu wenig dialektisch. Der Kapitalismus ist keine monolithische Macht, die uns gegenübertritt und uns etwas wegnimmt. Es sind Prozesse, in denen unsere Versuche, unverwechselbare Individuen zu sein, in Profitstrukturen überführt werden – was deswegen so gut funktioniert, weil es tief in den Bedürfnissen der Menschen verwurzelt ist, es wird ihnen nicht aufgezwungen. Was Fukuyama mit dem Wort vom „Ende der Geschichte“ ausdrücken wollte, war, dass mit dem Sieg des Kapitalismus auch die liberale Demokratie weltweit siegt. Das war ein Irrtum, wie wir gesehen haben. In den Neunzigern beginnt auch der Aufstieg des politischen Islam, die Rückkehr religiöser und nationalistischer Fundamentalismen im allgemeinen. Und sie enden mit dem Dschihad von Osama bin Laden gegen den „Westen“ – und mit der Amtsübernahme von Wladimir Putin in Russland. Das ist der beste Beweis dafür, dass kapitalistische Profitgier sich in autoritären Regierungsformen gut ausleben lässt – und sich auch mit imperialistischem Großmachtstreben bestens verträgt.
Ebenfalls auf kaput erschien: Die Besprechung des neuen Buchs von Jens Balzer: „No Limit“